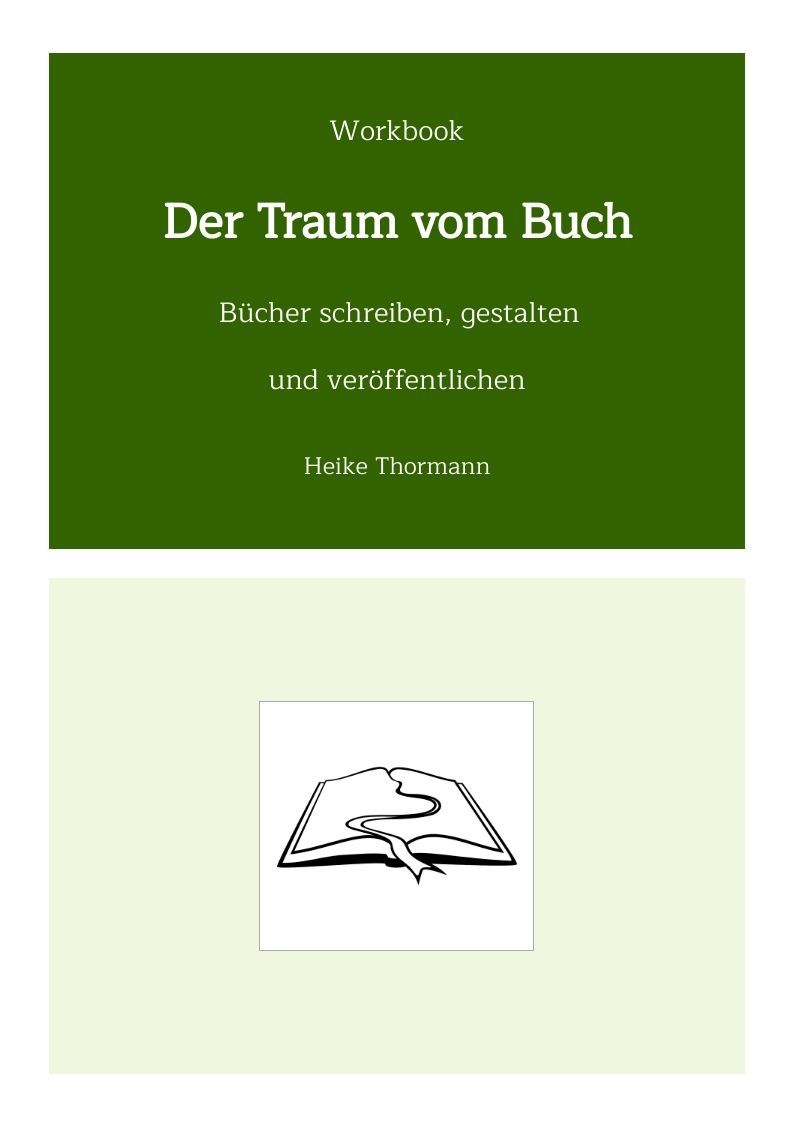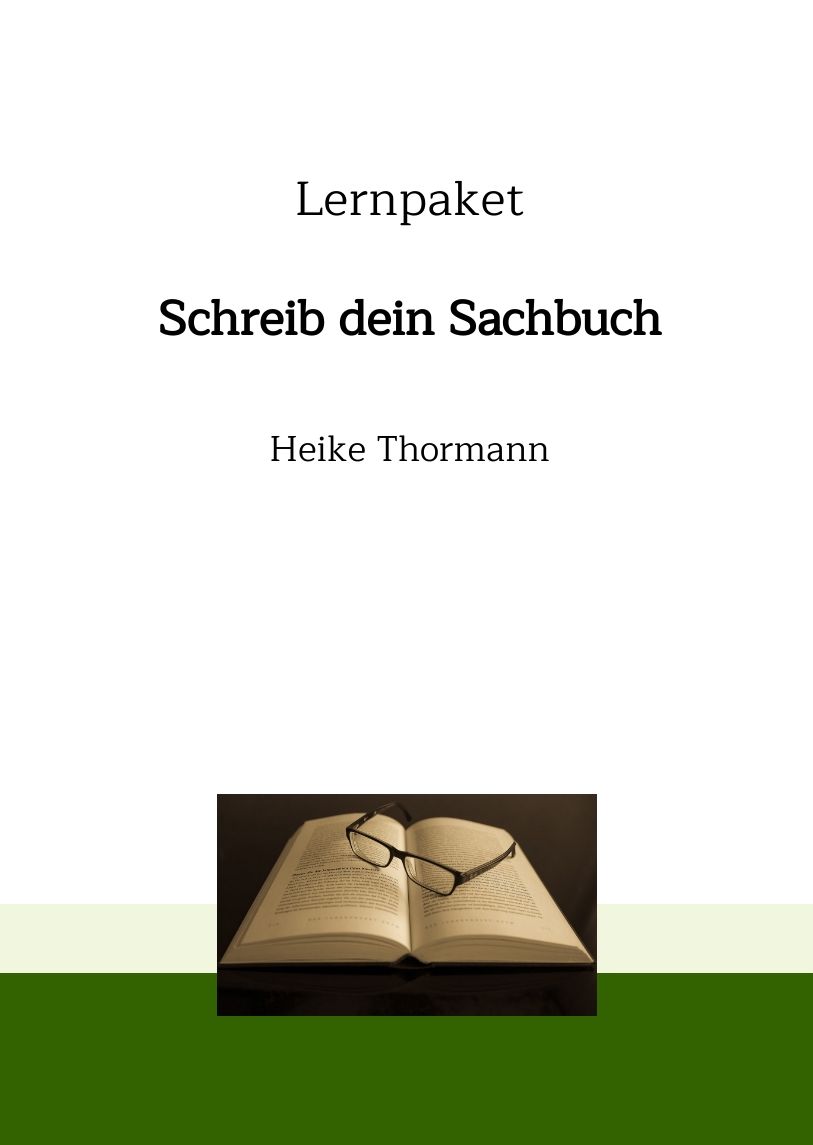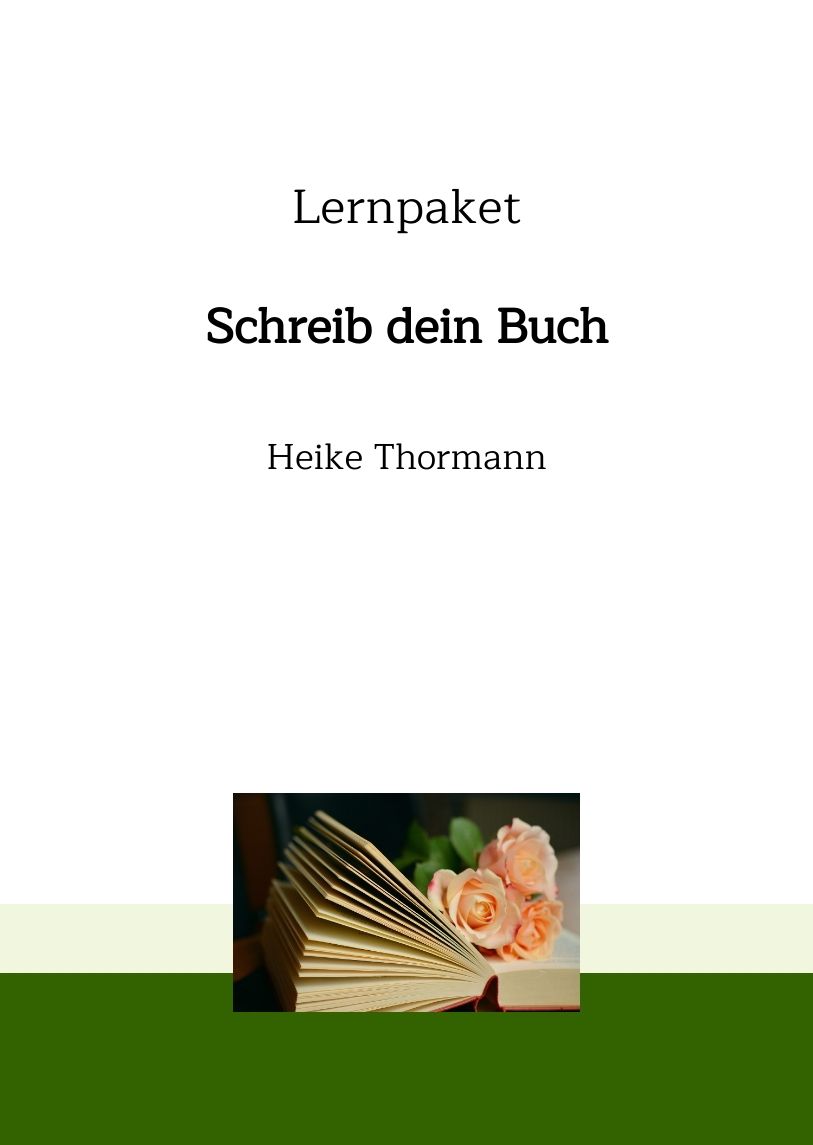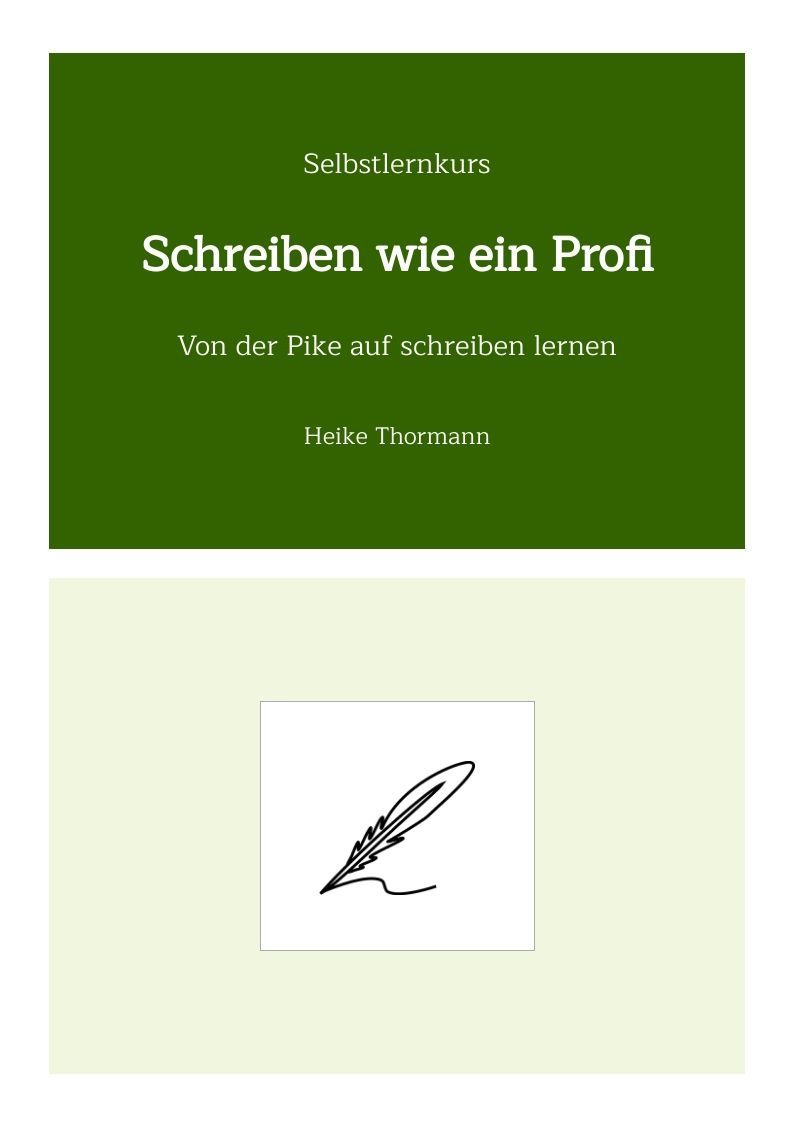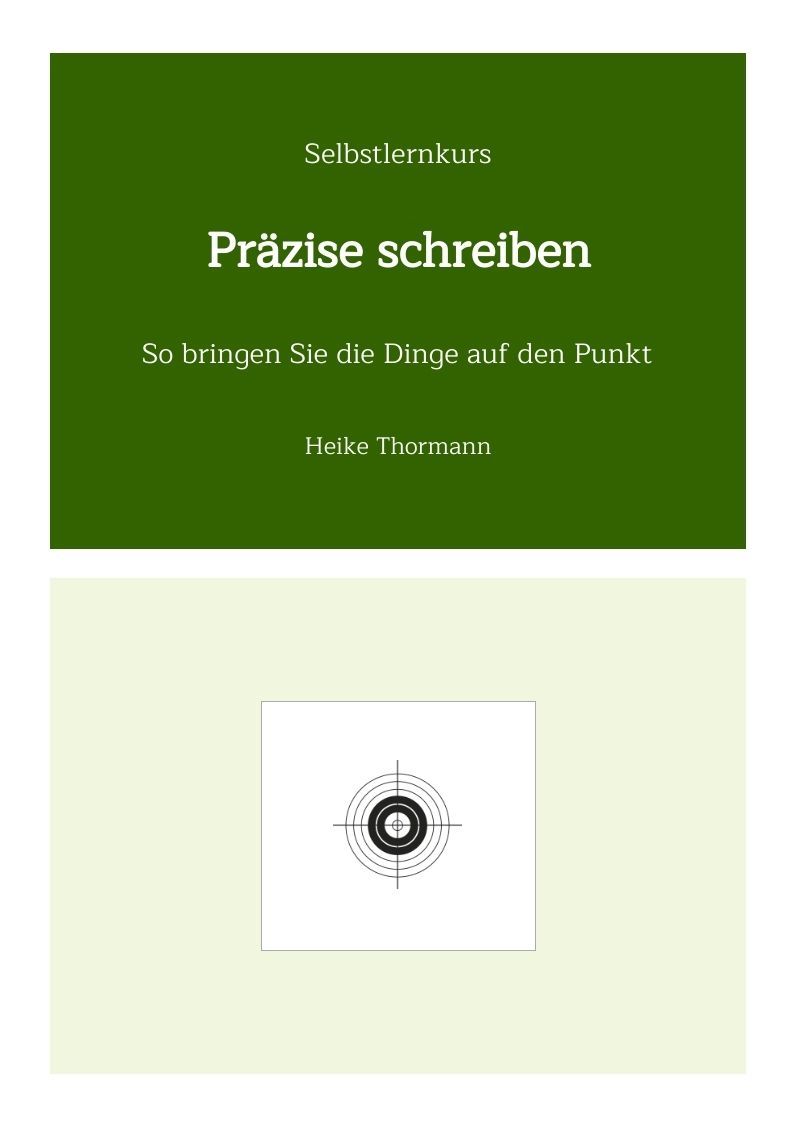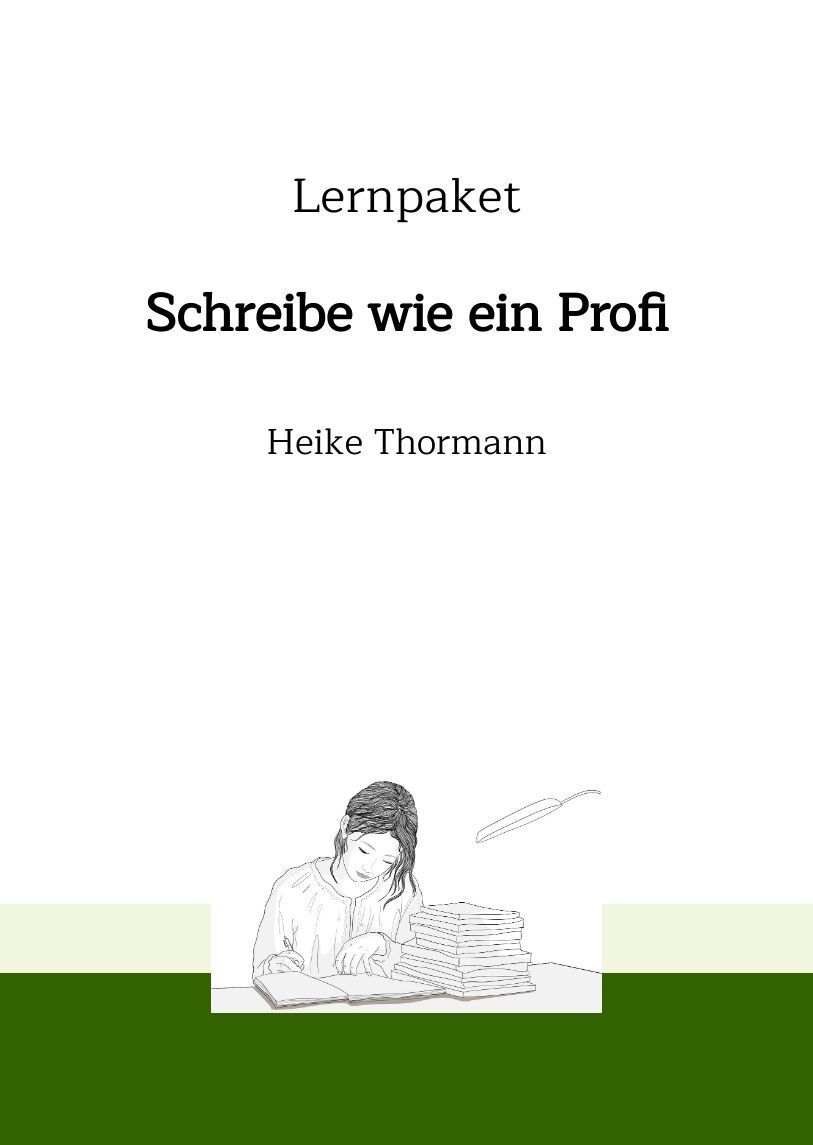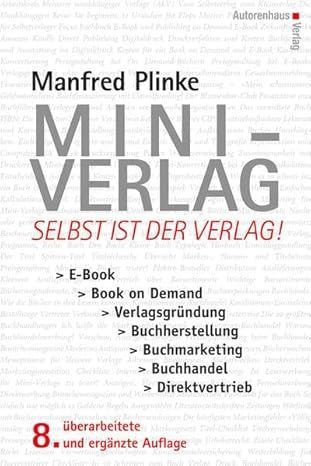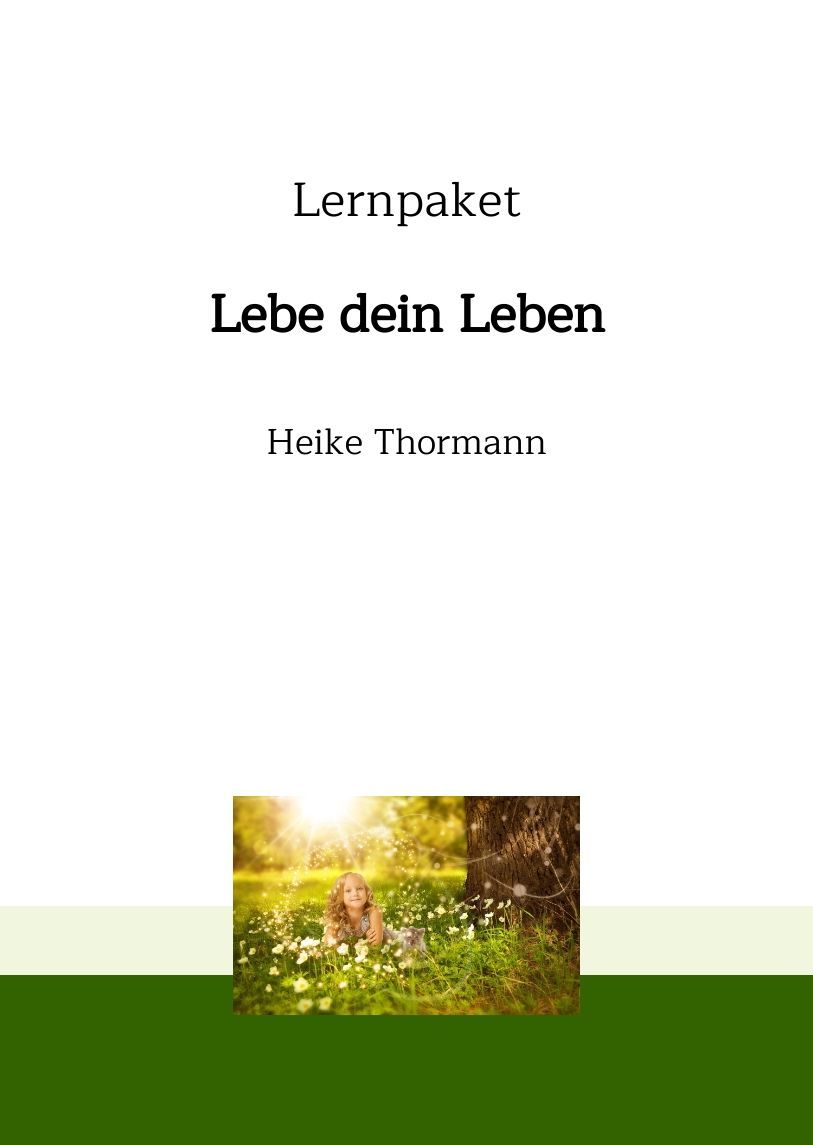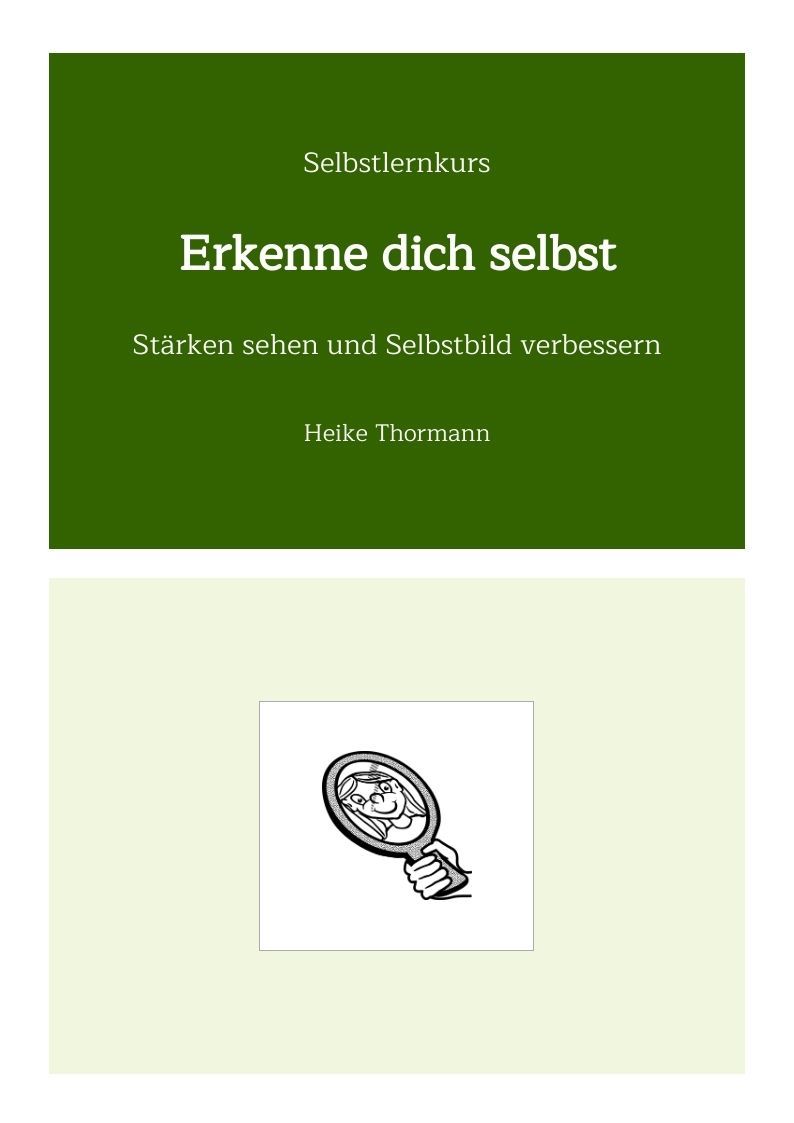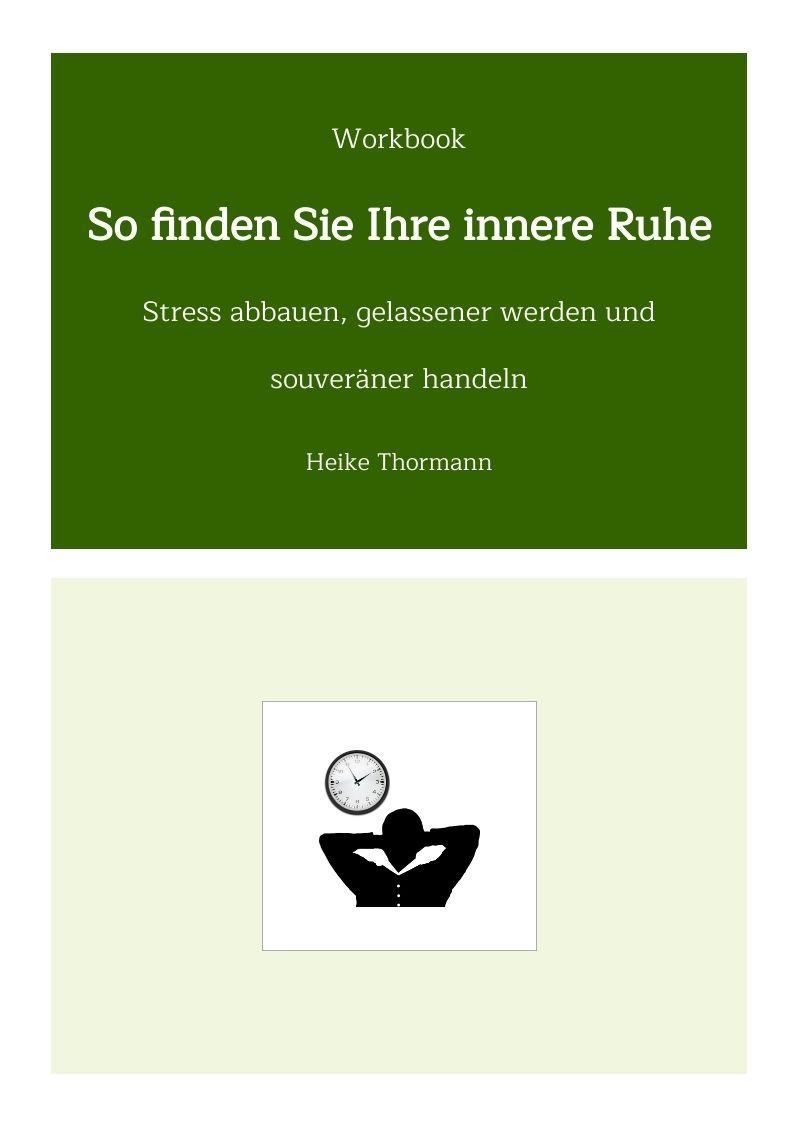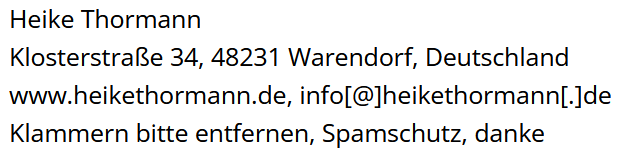Artikel
"Zeitformen für Autoren"
von Heike Thormann
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt.
Zeitformen oder Tempora sind Schulstoff, Basiswissen. Doch einfach sind sie deshalb nicht. Wann setze ich welche Zeit, welche Zeit wähle ich für welche Texte? Ich stelle Ihnen hier die gängigsten Regeln vor, gehe auf Unterschiede zwischen Alltags- und Schriftsprache ein und beschreibe kurz die beiden "Haupt-Erzählzeiten" Gegenwart und Vergangenheit.
Ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass Zeitformen ein Thema für einen Artikel sein können. Das war für mich Schulwissen, vermutlich auch eher selbstverständlich. Oder? Doch dann fragte eine Coachee danach – interessehalber warf ich einen Blick auf den Stoff – und ich entdeckte, dass Zeitformen spannender und ergiebiger sein können, als ich annahm.
So ist mir jetzt zum Beispiel klar, warum ich oft mehrere Formulierungen gleichzeitig für ein und dieselbe Sache im Kopf habe: Vieles ist entweder "Alltagssprache" oder "Schriftsprache".
Auch können falsch gesetzte Zeiten wie ein Misston klingen und sozusagen "Zahnschmerzen" verursachen. Beispiel: "Ich sah, dass Tom ein blaues Auge hatte, das mir in der letzten Nacht nicht auffiel." Richtig wäre gewesen: "Ich sah, dass Tom ein blaues Auge hatte, das mir in der letzten Nacht nicht aufgefallen war." (Plusquamperfekt; Zitat nach LeGuin S. 93, Literatur siehe unten.)
Ich gehe davon aus, dass die Muttersprachler unter Ihnen mehr oder weniger wissen, wie die Zeiten gebildet werden. Deshalb konzentriere ich mich in diesem Artikel darauf, welche Zeit wann wie gebraucht wird. Und ich konzentriere mich vor allem auf Autoren und Texte.
Noch eines vorweg: Begriffe wie Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft können bei Zeitformen immer nur fiktiv sein. Ein Ereignis, das ein Autor in der "Gegenwart" (also im Präsens) beschreibt, wird nur selten der Gegenwart des Lesers entsprechen. Eine solche echte oder "1:1 Gegenwart" ist nur bei Live-Übertragungen und Ähnlichem möglich. Man spricht deshalb auch davon, dass ein Ereignis "vom Zeitpunkt des Sprechens oder Schreibens aus" betrachtet wird. (Ausdruck nach Wermke, Literatur siehe unten.)
Gut, nun wünsche ich Ihnen viel Spaß mit den Zeiten.
Viele Texte werden im Deutschen in der Gegenwartsform, im Präsens, geschrieben.
Pressemitteilungen oder Werbetexte informieren zum Beispiel, dass die Firma xx seit Kurzem erweiterte Öffnungszeiten hat und Kunden jetzt länger einkaufen können. Nachrichten oder journalistische Texte berichten, dass der neue Bürgermeister am yy sein Amt aufnimmt. Bedienungsanleitungen oder Ratgebertexte meinen, dass man dieses tun soll oder jenes mit zz erreichen kann. Romane oder (Auto-)Biografien wollen Nähe zum Leser herstellen, indem sie beispielsweise die Heldin sich die dunkle Kellertreppe "hinuntertasten" lassen. Durch die Gegenwartsform soll der Leser animiert werden, ihr "zeitgleich" Stück für Stück zu folgen.
In einem längeren Essay hat sich die Schriftstellerin Ursula K. LeGuin gegen diese verbreitete Praxis ausgesprochen. Für sie gehören Präsens und Unmittelbarkeit, Nähe, Gleichzeitigkeit (mit dem Leser) nicht zwangsläufig zusammen. Sie meint, sie habe etliche Texte in der Vergangenheitsform gesehen, die dem Leser Nähe erlaubt hätten, und etliche Texte in der Gegenwartsform, bei denen das definitiv nicht gelungen sei.
Vielleicht ist das Ganze eine Frage der Perspektive: Für viele Autoren bedeutet "Nähe" oder "Unmittelbarkeit", dass man den Figuren und der Handlung hautnah folgen kann. Und das kann durch das Präsens in der Tat gefördert werden, es wirkt wie ein Scheinwerfer. Zudem gewinnt die Geschichte dadurch an Tempo, der Autor kann die Spannung erhöhen.
Für Ursula LeGuin scheint "Nähe" dagegen eher eine emotionale Nähe zu sein: Ist der Leser in der Lage, den komplexen Verflechtungen von Handlungen und Figuren zu folgen? Oder muss er wie der genannte Scheinwerfer am gerade Geschilderten "kleben"? Ist der Leser in der Lage, die Entwicklungen der Figuren zu begreifen? Oder nimmt er vorzugsweise den aktuellen Stand der Dinge wahr? Für diese so verstandene "emotionale Nähe" kann in der Tat das Präteritum besser geeignet sein.
Tipp: Probieren Sie gegebenenfalls aus, wie Ihre Geschichte in beiden Zeiten wirkt. Entscheiden Sie dann, welche Zeit für Ihre Zwecke besser geeignet ist. Oder schreiben Sie Ihre Geschichten hauptsächlich in der Vergangenheit und greifen Sie nur für manche Szenen zum Präsens. Wählen Sie die Erzählzeit je nach ihrer Wirkung und der von Ihnen angestrebten Absicht aus. Und machen Sie den Zeitenwechsel am besten durch Absätze oder Leerzeilen optisch sichtbar.
In der (mündlichen) Alltags- oder Umgangssprache kommen solche Wechsel von der "Vergangenheit" in die "Gegenwart" noch schneller und reibungsloser vor: "Ich bin gestern nach T. gefahren. Meine Mama und ich hatten unseren Frauentag. Da fängt es aber auch plötzlich an zu schütten, Du glaubst es nicht. Richtig dicke Hagelkörner kamen da runter …"
Das Perfekt ist keine "Haupt-Erzählzeit". Sie müssen sich nicht überlegen, ob Sie es nutzen sollen, weil Sie etwas "in der Vergangenheit" oder "in der Gegenwart" erzählen wollen. Meistens taucht es lediglich zusammen mit anderen Zeiten auf. Nur in der (mündlichen) Alltags- oder Umgangssprache begegnet es häufiger. Dort ersetzt es oft das Imperfekt/Präteritum.
In der (mündlichen) Alltags- oder Umgangssprache steht das Perfekt, wie gesagt, oft anstelle des Imperfekts/Präteritums: "Ich habe in diesem Keller echt gelitten. Das nächste Mal muss ein anderer die Kartoffeln holen."
Viele Texte werden im Deutschen auch in der Vergangenheitsform, im Imperfekt beziehungsweise Präteritum, geschrieben.
Pressemitteilungen können über Ereignisse der jüngsten Vergangenheit berichten, das Gleiche gilt für Nachrichten. Populärwissenschaftliche Artikel erzählen zum Beispiel, wie die Erde entstand, journalistische Artikel lassen den Leser vielleicht am Bau des neuen Museums teilnehmen. Sehr viele Romane sind in der Vergangenheitsform geschrieben, ebenso viele (Auto-)Biografien.
In der Schriftsprache ist das Präteritum (anderer Begriff: Imperfekt) die Haupt-Erzählzeit von allem, was in der Vergangenheit passiert ist. Es steht bei Erzählungen genauso wie bei Berichten, beim Roman genauso wie im Protokoll. In der (mündlichen) Alltags- oder Umgangssprache hat sich allerdings, wie oben erwähnt, zur Schilderung vergangener Ereignisse oft das Perfekt durchgesetzt.
In der (mündlichen) Alltags- oder Umgangssprache wird für Darstellungen der Vergangenheit, wie gesagt, meist das Perfekt benutzt.
Auch das Plusquamperfekt ist keine "Haupt-Erzählzeit". Es kommt wieder zusammen mit anderen Zeiten vor, diesmal mit dem Präteritum oder dem Perfekt. Immer wenn Sie über etwas in der Vergangenheit schreiben, das sich vor einer anderen Sache in der Vergangenheit ereignet hat, ist das Plusquamperfekt gefragt. Typischerweise setzen Sie dazu beide Ereignisse zueinander in Beziehung.
In der (mündlichen) Alltags- oder Umgangssprache wird das Plusquamperfekt teils durch Perfekt oder Präteritum ersetzt. ("Über 1000 Besucher strömten am ersten Tag ins neue Museum. Der Aufmacher in der Tageszeitung hat sich offensichtlich gelohnt." Perfekt, möglicherweise steht gedacht das Ergebnis im Vordergrund.)
Auch das Futur I dürfte nur selten eine "Haupt-Erzählzeit" sein. Vielleicht weisen Pressemitteilungen, Nachrichten oder Vergleichbares noch knapp und im Futur auf zukünftige Ereignisse hin. Doch sonst wird es eher wieder im Zusammenspiel mit anderen Zeiten vorkommen; in vielen Fällen kann es sogar durch das Präsens ersetzt werden.
Im alltäglichen Sprach- wie Schriftgebrauch (!) wird das Futur I oft durch das Präsens ersetzt. Das gilt für zukünftige Absichten und Ereignisse genauso wie für Vermutungen. Bei Absichten und Ereignissen kommt es aber auf den jeweiligen Satz an, ob ein Präsens möglich ist, während Vermutungen durch begleitende Worte wie wohl, vermutlich, bestimmt, sicher als solche kenntlich sind und daher grundsätzlich auch im Präsens stehen können.
Beim Futur II verhält es sich ähnlich wie beim Futur I, nur dass es – wie Perfekt und Plusquamperfekt – keine eigene Erzählzeit darstellt, sondern wieder im Zusammenhang mit anderen Zeitformen steht.
In der (mündlichen) Alltags- oder Umgangssprache taucht das Futur II noch seltener auf als das Futur I. Teilweise wird es durch andere Zeiten ersetzt, teilweise auch durch andere Formulierungen und Umschreibungen.
Ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass Zeitformen ein Thema für einen Artikel sein können. Das war für mich Schulwissen, vermutlich auch eher selbstverständlich. Oder? Doch dann fragte eine Coachee danach – interessehalber warf ich einen Blick auf den Stoff – und ich entdeckte, dass Zeitformen spannender und ergiebiger sein können, als ich annahm.
So ist mir jetzt zum Beispiel klar, warum ich oft mehrere Formulierungen gleichzeitig für ein und dieselbe Sache im Kopf habe: Vieles ist entweder "Alltagssprache" oder "Schriftsprache".
Auch können falsch gesetzte Zeiten wie ein Misston klingen und sozusagen "Zahnschmerzen" verursachen. Beispiel: "Ich sah, dass Tom ein blaues Auge hatte, das mir in der letzten Nacht nicht auffiel." Richtig wäre gewesen: "Ich sah, dass Tom ein blaues Auge hatte, das mir in der letzten Nacht nicht aufgefallen war." (Plusquamperfekt; Zitat nach LeGuin S. 93, Literatur siehe unten.)
Ich gehe davon aus, dass die Muttersprachler unter Ihnen mehr oder weniger wissen, wie die Zeiten gebildet werden. Deshalb konzentriere ich mich in diesem Artikel darauf, welche Zeit wann wie gebraucht wird. Und ich konzentriere mich vor allem auf Autoren und Texte.
Noch eines vorweg: Begriffe wie Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft können bei Zeitformen immer nur fiktiv sein. Ein Ereignis, das ein Autor in der "Gegenwart" (also im Präsens) beschreibt, wird nur selten der Gegenwart des Lesers entsprechen. Eine solche echte oder "1:1 Gegenwart" ist nur bei Live-Übertragungen und Ähnlichem möglich. Man spricht deshalb auch davon, dass ein Ereignis "vom Zeitpunkt des Sprechens oder Schreibens aus" betrachtet wird. (Ausdruck nach Wermke, Literatur siehe unten.)
Gut, nun wünsche ich Ihnen viel Spaß mit den Zeiten.
"Die Gegenwart" (Präsens)
Viele Texte werden im Deutschen in der Gegenwartsform, im Präsens, geschrieben.
Pressemitteilungen oder Werbetexte informieren zum Beispiel, dass die Firma xx seit Kurzem erweiterte Öffnungszeiten hat und Kunden jetzt länger einkaufen können. Nachrichten oder journalistische Texte berichten, dass der neue Bürgermeister am yy sein Amt aufnimmt. Bedienungsanleitungen oder Ratgebertexte meinen, dass man dieses tun soll oder jenes mit zz erreichen kann. Romane oder (Auto-)Biografien wollen Nähe zum Leser herstellen, indem sie beispielsweise die Heldin sich die dunkle Kellertreppe "hinuntertasten" lassen. Durch die Gegenwartsform soll der Leser animiert werden, ihr "zeitgleich" Stück für Stück zu folgen.
Das Präsens steht also
- bei Fakten, Tatsachen, Handlungen, Situationen, Zuständen in der Gegenwart ("die Firma xx hat neue Öffnungszeiten")
- aber auch bei Fakten, Tatsachen, Handlungen, Situationen, Zuständen in der Zukunft, die zum Zeitpunkt des Sprechens/Schreibens bereits bekannt sind ("der neue Bürgermeister tritt am yy sein Amt an")
- wenn der Autor versucht, Unmittelbarkeit, Nähe, Gleichzeitigkeit in der Gegenwart herzustellen ("mit angehaltenem Atem tastet sie sich langsam in die Dunkelheit voran")
- aber auch bei Unmittelbarkeit, Nähe, Gleichzeitigkeit für die Vergangenheit ("die 1980er Jahre sind die Blütezeit ihrer Karriere, jetzt eilt sie von Erfolg zu Erfolg") oder in der Vergangenheit ("nach seiner Wahl sagte der Bürgermeister, dass er sich seiner Verantwortung für die Gemeinde bewusst ist")
- sowie bei allem, was als allgemeingültig angesehen wird ("alles liegt im Auge des Betrachters") oder in der Vergangenheit als allgemeingültig angesehen wurde ("später sagte sie oft, dass der Erfolg seine Kinder frisst").
In einem längeren Essay hat sich die Schriftstellerin Ursula K. LeGuin gegen diese verbreitete Praxis ausgesprochen. Für sie gehören Präsens und Unmittelbarkeit, Nähe, Gleichzeitigkeit (mit dem Leser) nicht zwangsläufig zusammen. Sie meint, sie habe etliche Texte in der Vergangenheitsform gesehen, die dem Leser Nähe erlaubt hätten, und etliche Texte in der Gegenwartsform, bei denen das definitiv nicht gelungen sei.
Vielleicht ist das Ganze eine Frage der Perspektive: Für viele Autoren bedeutet "Nähe" oder "Unmittelbarkeit", dass man den Figuren und der Handlung hautnah folgen kann. Und das kann durch das Präsens in der Tat gefördert werden, es wirkt wie ein Scheinwerfer. Zudem gewinnt die Geschichte dadurch an Tempo, der Autor kann die Spannung erhöhen.
Für Ursula LeGuin scheint "Nähe" dagegen eher eine emotionale Nähe zu sein: Ist der Leser in der Lage, den komplexen Verflechtungen von Handlungen und Figuren zu folgen? Oder muss er wie der genannte Scheinwerfer am gerade Geschilderten "kleben"? Ist der Leser in der Lage, die Entwicklungen der Figuren zu begreifen? Oder nimmt er vorzugsweise den aktuellen Stand der Dinge wahr? Für diese so verstandene "emotionale Nähe" kann in der Tat das Präteritum besser geeignet sein.
Tipp: Probieren Sie gegebenenfalls aus, wie Ihre Geschichte in beiden Zeiten wirkt. Entscheiden Sie dann, welche Zeit für Ihre Zwecke besser geeignet ist. Oder schreiben Sie Ihre Geschichten hauptsächlich in der Vergangenheit und greifen Sie nur für manche Szenen zum Präsens. Wählen Sie die Erzählzeit je nach ihrer Wirkung und der von Ihnen angestrebten Absicht aus. Und machen Sie den Zeitenwechsel am besten durch Absätze oder Leerzeilen optisch sichtbar.
Alltagssprache, Umgangssprache:
In der (mündlichen) Alltags- oder Umgangssprache kommen solche Wechsel von der "Vergangenheit" in die "Gegenwart" noch schneller und reibungsloser vor: "Ich bin gestern nach T. gefahren. Meine Mama und ich hatten unseren Frauentag. Da fängt es aber auch plötzlich an zu schütten, Du glaubst es nicht. Richtig dicke Hagelkörner kamen da runter …"
"Die abgeschlossene oder vollendete Gegenwart" (Perfekt)
Das Perfekt ist keine "Haupt-Erzählzeit". Sie müssen sich nicht überlegen, ob Sie es nutzen sollen, weil Sie etwas "in der Vergangenheit" oder "in der Gegenwart" erzählen wollen. Meistens taucht es lediglich zusammen mit anderen Zeiten auf. Nur in der (mündlichen) Alltags- oder Umgangssprache begegnet es häufiger. Dort ersetzt es oft das Imperfekt/Präteritum.
Das Perfekt steht
- bei Handlungen, Situationen, Zuständen, die in der Vergangenheit abgeschlossen wurden und deren Ergebnis a) zum Zeitpunkt des Sprechens/Schreibens im Vordergrund steht, b) in der Gegenwart zu sehen ist oder c) für die Gegenwart relevant ist ("die Firma xx hat ihre Öffnungszeiten ausgedehnt, Kunden können nun …" oder "der Bürgermeister hat sich vorgenommen, sein Bestes für die Gemeinde zu geben")
- seltener auch bei Handlungen, Situationen, Zuständen, die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft abgeschlossen sein werden ("bis zum Ende der Amtszeit hat er viele Vorsätze vielleicht schon wieder vergessen")
Alltagssprache, Umgangssprache:
In der (mündlichen) Alltags- oder Umgangssprache steht das Perfekt, wie gesagt, oft anstelle des Imperfekts/Präteritums: "Ich habe in diesem Keller echt gelitten. Das nächste Mal muss ein anderer die Kartoffeln holen."
"Die Vergangenheit" (Imperfekt bzw. Präteritum)
Viele Texte werden im Deutschen auch in der Vergangenheitsform, im Imperfekt beziehungsweise Präteritum, geschrieben.
Pressemitteilungen können über Ereignisse der jüngsten Vergangenheit berichten, das Gleiche gilt für Nachrichten. Populärwissenschaftliche Artikel erzählen zum Beispiel, wie die Erde entstand, journalistische Artikel lassen den Leser vielleicht am Bau des neuen Museums teilnehmen. Sehr viele Romane sind in der Vergangenheitsform geschrieben, ebenso viele (Auto-)Biografien.
In der Schriftsprache ist das Präteritum (anderer Begriff: Imperfekt) die Haupt-Erzählzeit von allem, was in der Vergangenheit passiert ist. Es steht bei Erzählungen genauso wie bei Berichten, beim Roman genauso wie im Protokoll. In der (mündlichen) Alltags- oder Umgangssprache hat sich allerdings, wie oben erwähnt, zur Schilderung vergangener Ereignisse oft das Perfekt durchgesetzt.
Das Präteritum steht
- bei Fakten, Tatsachen, Handlungen, Situationen, Zuständen in der Vergangenheit ("vor vielen Millionen Jahren bildete sich erstes Leben auf der Erde")
- auch bei Fakten, Tatsachen, Handlungen, Situationen, Zuständen in der Vergangenheit, die noch als aktuell wahrgenommen werden ("über 1000 Besucher strömten am ersten Tag ins neue Museum, das lässt die Betreiber optimistisch in die Zukunft blicken")
- sowie bei bestimmten Verben oder Infinitiv-Konstruktionen, die a) kein Perfekt zulassen ("meine Großmutter stammte aus Ostpreußen") oder b) von ihrer Bedeutung her das Präteritum erfordern ("meine Großmutter kam aus Ostpreußen" im Sinne von "dort war ihre Heimat", nicht im Sinne von "sie ist (in die Küche o. Ä.) gekommen")
Alltagssprache, Umgangssprache:
In der (mündlichen) Alltags- oder Umgangssprache wird für Darstellungen der Vergangenheit, wie gesagt, meist das Perfekt benutzt.
Ausnahmen sind zum Beispiel
- Kombinationen mit haben ("meine Herrn, ich hatte vielleicht eine Panik in dem Keller") oder sein ("gestern war ich in T. – und Du?")
- Kombinationen mit den Modalverben dürfen, können, müssen, mögen, wollen, sollen ("Konntest Du auch gestern nicht nach T.? Einige Züge sollen nicht gefahren sein …")
"Die Vorvergangenheit oder vollendete Vergangenheit" (Plusquamperfekt)
Auch das Plusquamperfekt ist keine "Haupt-Erzählzeit". Es kommt wieder zusammen mit anderen Zeiten vor, diesmal mit dem Präteritum oder dem Perfekt. Immer wenn Sie über etwas in der Vergangenheit schreiben, das sich vor einer anderen Sache in der Vergangenheit ereignet hat, ist das Plusquamperfekt gefragt. Typischerweise setzen Sie dazu beide Ereignisse zueinander in Beziehung.
Beispiele
- "Über 1000 Besucher strömten am ersten Tag ins neue Museum (Präteritum), der Aufmacher in der Tageszeitung hatte sich offensichtlich gelohnt (Plusquamperfekt)."
- "Die Museumsleitung hatte einen großen Artikel in die Tageszeitung setzen lassen. (Plusquamperfekt) Offenbar mit Erfolg: Am ersten Tag strömten über 1000 Besucher … (Präteritum)"
- "Umfragen hatten eine zunehmende Unzufriedenheit der Kunden mit der Firmenpolitik ergeben. (Plusquamperfekt) Die Firma xx hat deshalb als erste Verbesserungsmaßnahme die Ausdehnung ihrer Öffnungszeiten beschlossen. (Perfekt)"
Alltagssprache, Umgangssprache:
In der (mündlichen) Alltags- oder Umgangssprache wird das Plusquamperfekt teils durch Perfekt oder Präteritum ersetzt. ("Über 1000 Besucher strömten am ersten Tag ins neue Museum. Der Aufmacher in der Tageszeitung hat sich offensichtlich gelohnt." Perfekt, möglicherweise steht gedacht das Ergebnis im Vordergrund.)
"Die Zukunft" (Futur I)
Auch das Futur I dürfte nur selten eine "Haupt-Erzählzeit" sein. Vielleicht weisen Pressemitteilungen, Nachrichten oder Vergleichbares noch knapp und im Futur auf zukünftige Ereignisse hin. Doch sonst wird es eher wieder im Zusammenspiel mit anderen Zeiten vorkommen; in vielen Fällen kann es sogar durch das Präsens ersetzt werden.
Das Futur I steht
- bei Absichten für die Zukunft ("der Bürgermeister wird sich auch für die nächste Legislaturperiode wieder zur Wahl stellen") oder Ereignissen in der Zukunft ("nächstes Jahr werden sich die Bürger wieder ein neues Oberhaupt wählen können")
- sowie bei Vermutungen für die Zukunft ("das Museum wird wohl noch etwas Zeit brauchen, bis es in der Bevölkerung bekannter ist") und sogar für die Gegenwart ("Warum ist das Museum geschlossen?" "Es wird seinen Ruhetag haben." -> Im Sinne von "Ich vermute, dass es seinen Ruhetag hat.")
Alltäglicher Gebrauch:
Im alltäglichen Sprach- wie Schriftgebrauch (!) wird das Futur I oft durch das Präsens ersetzt. Das gilt für zukünftige Absichten und Ereignisse genauso wie für Vermutungen. Bei Absichten und Ereignissen kommt es aber auf den jeweiligen Satz an, ob ein Präsens möglich ist, während Vermutungen durch begleitende Worte wie wohl, vermutlich, bestimmt, sicher als solche kenntlich sind und daher grundsätzlich auch im Präsens stehen können.
Beispiele
- "Nächste Woche öffnet die Firma xx zum ersten Mal schon um 8 Uhr früh ihre Tore." (Ereignis, auch gestützt durch die Zeitbestimmung "nächste Woche")
- "In diesen Keller geht sie wohl nicht noch einmal." (Vermutung)
"Die vollendete Zukunft" (Futur II)
Beim Futur II verhält es sich ähnlich wie beim Futur I, nur dass es – wie Perfekt und Plusquamperfekt – keine eigene Erzählzeit darstellt, sondern wieder im Zusammenhang mit anderen Zeitformen steht.
Das Futur II steht
- bei Absichten oder Ereignissen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft abgeschlossen sein werden ("In zwei Monaten wird das Museum den neuen Raum für die Sonderausstellungen fertiggestellt haben.")
- sowie bei Vermutungen für die Vergangenheit (!) ("sie wird sich in dem Keller (wohl) erschrocken haben", mit oder ohne das begleitende "wohl")
Alltagssprache, Umgangssprache:
In der (mündlichen) Alltags- oder Umgangssprache taucht das Futur II noch seltener auf als das Futur I. Teilweise wird es durch andere Zeiten ersetzt, teilweise auch durch andere Formulierungen und Umschreibungen.
Beispiele
- "In zwei Monaten sind sie mit dem neuen Raum fertig, dann können wir …" (Präsens, andere Wortwahl, vielleicht wird hier das Ergebnis oder der Zustand gesehen)
- "Sie hat sich wohl erschrocken." (Perfekt, Vermutung gestützt durch das Wort "wohl", eventuell steht auch bei dieser Formulierung wieder das Ergebnis im Vordergrund)
Literaturtipps:
- Ursula K. LeGuin: Kleiner Autoren-Workshop
(*) Partner-Link zu Amazon, kleine Umsatzbeteiligung für mich
Copyright Heike Thormann
Auf dieser Webseite veröffentlicht am 2.4.2025
Erstveröffentlichung 2015, letzte Überarbeitung 2025
Möchten Sie sich für meine Artikel mit einer kleinen Spende bedanken? Dann sage ich herzlichen Dank. :-) (QR-Code oder Button zu Paypal.)