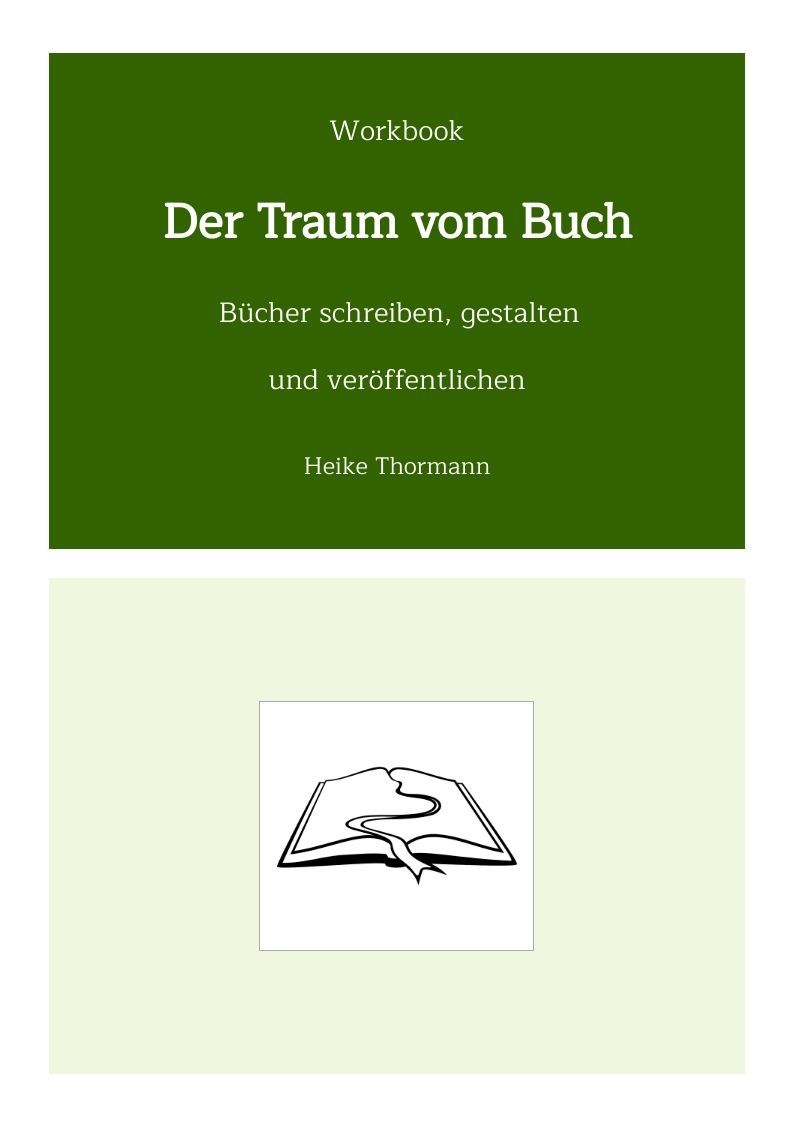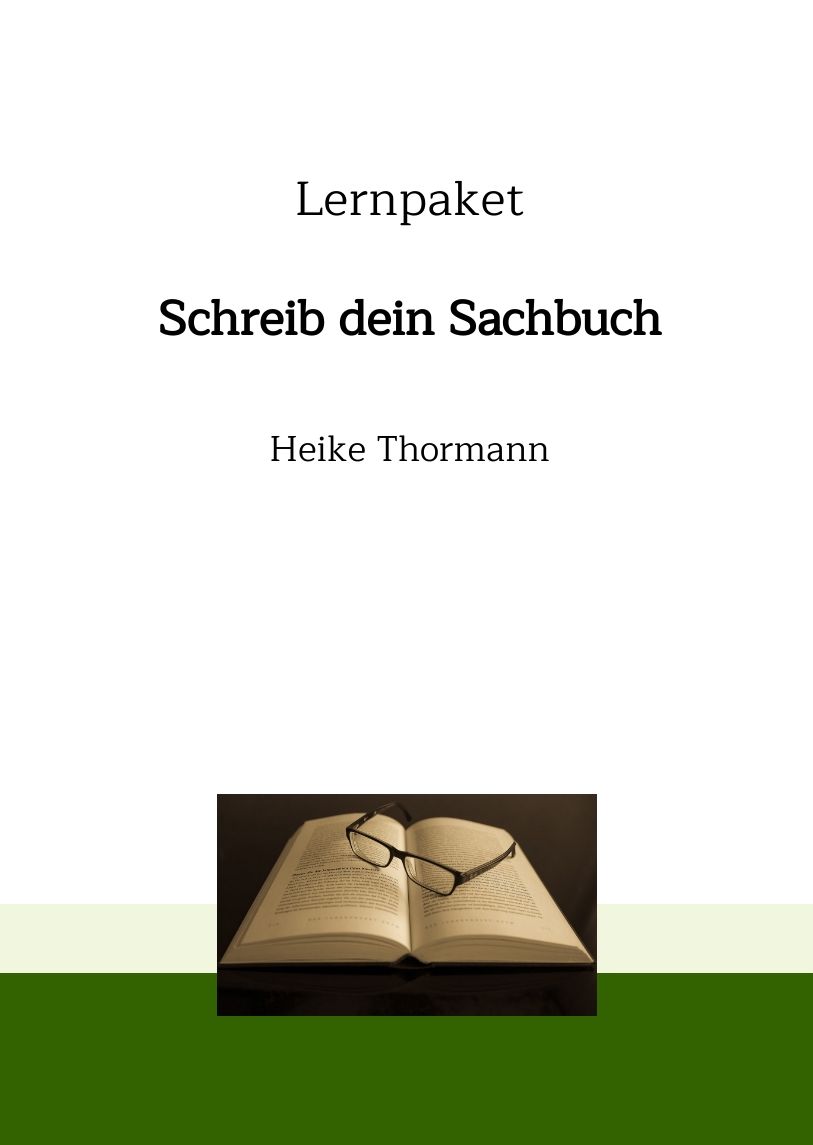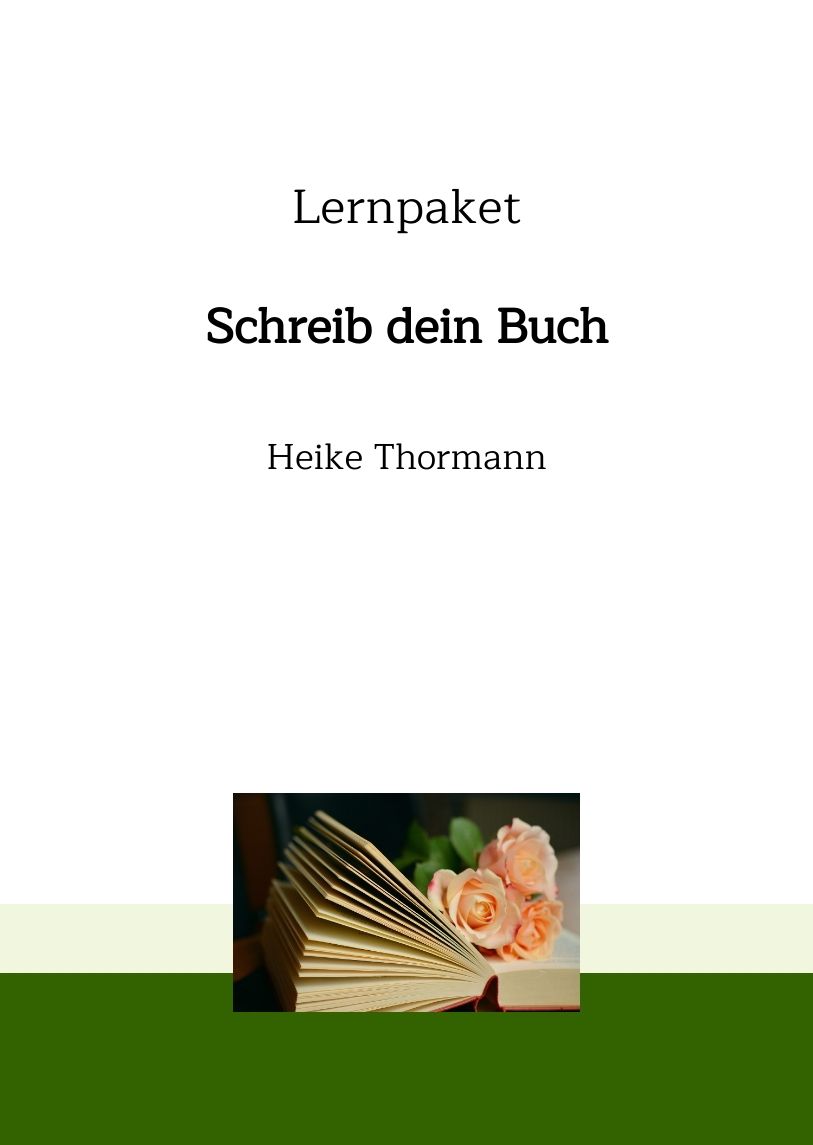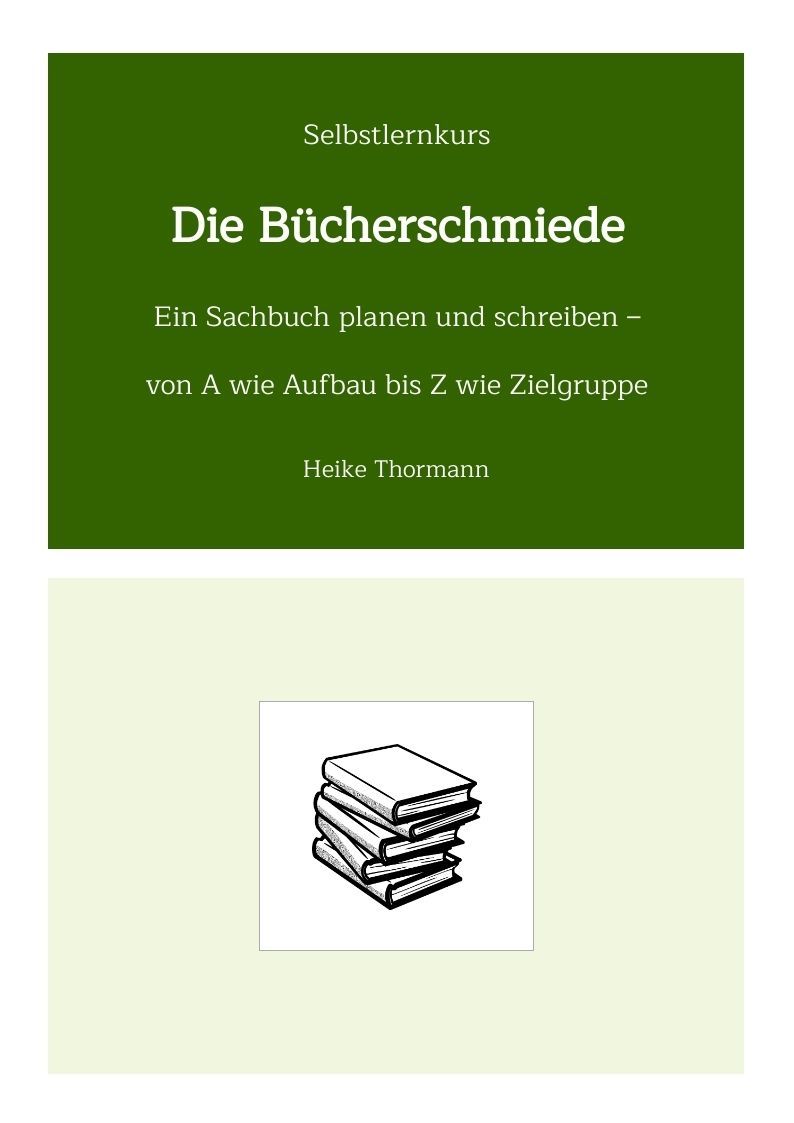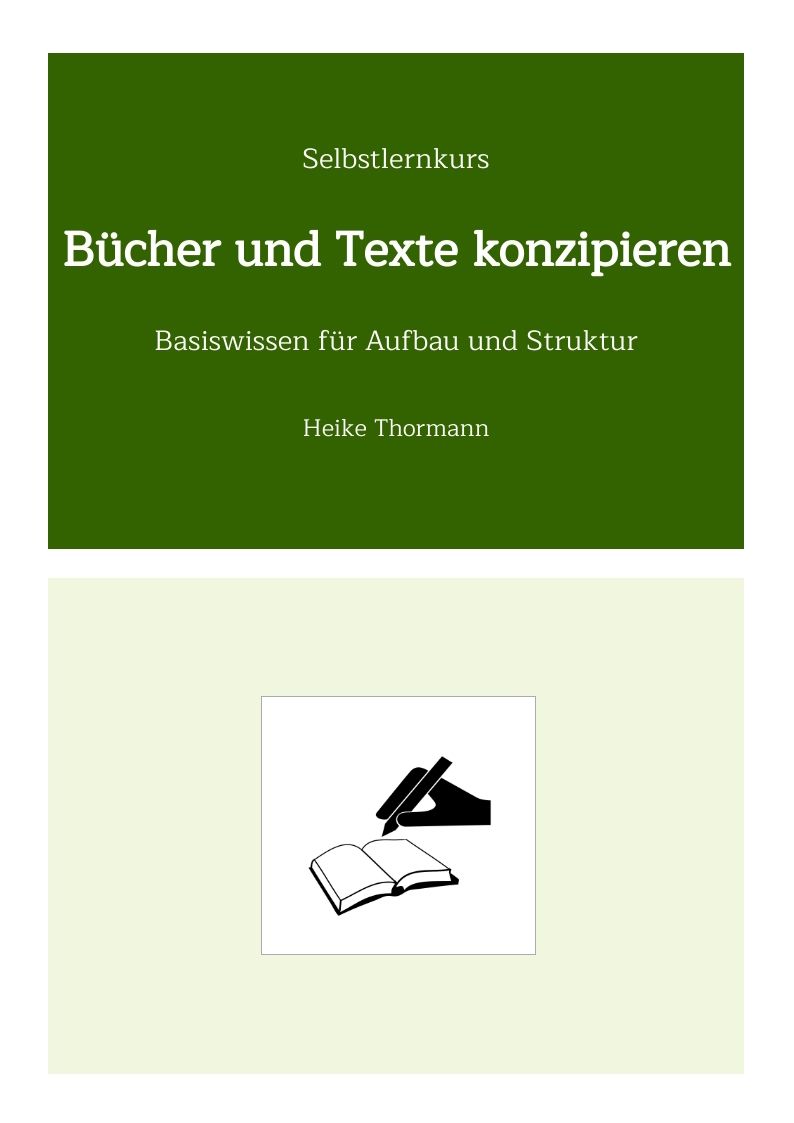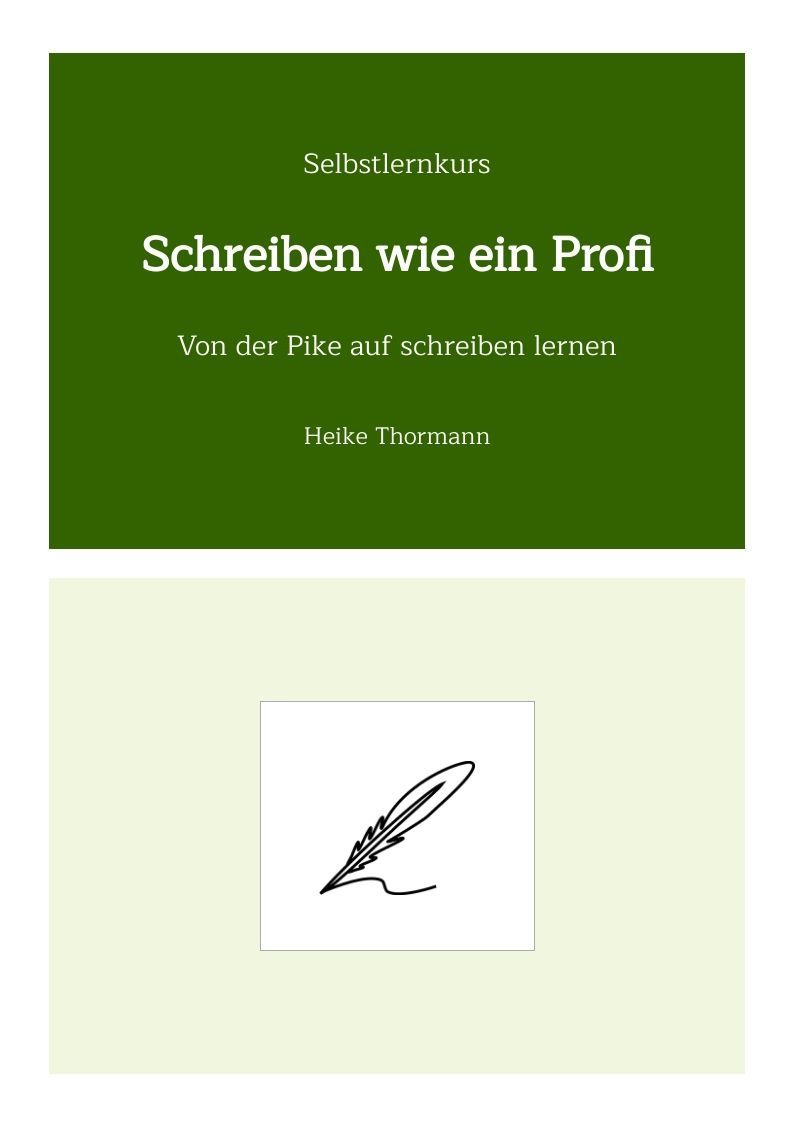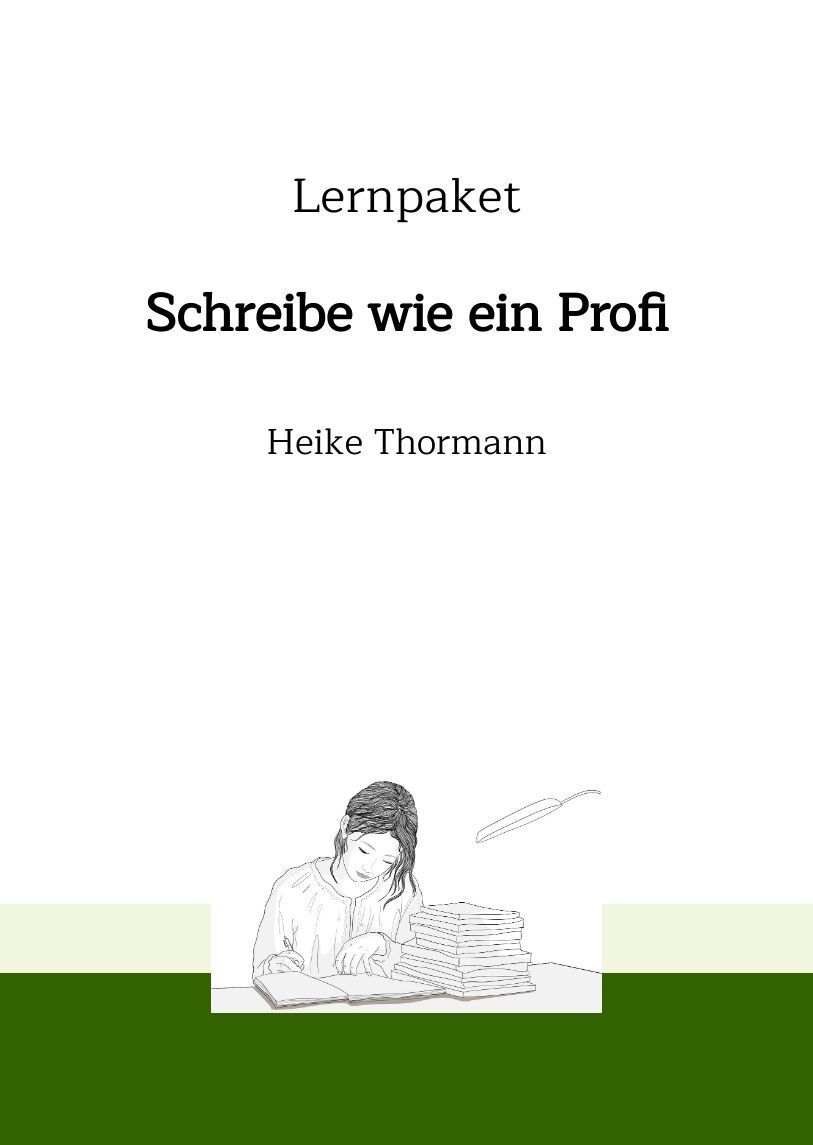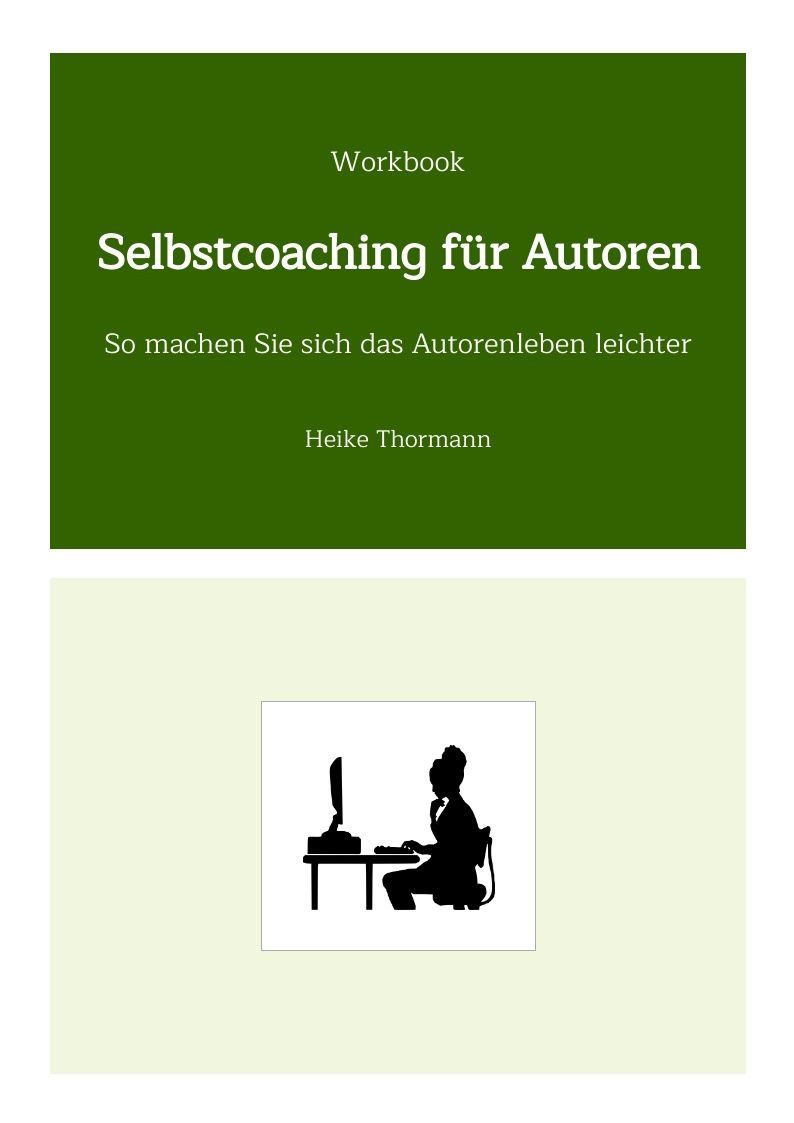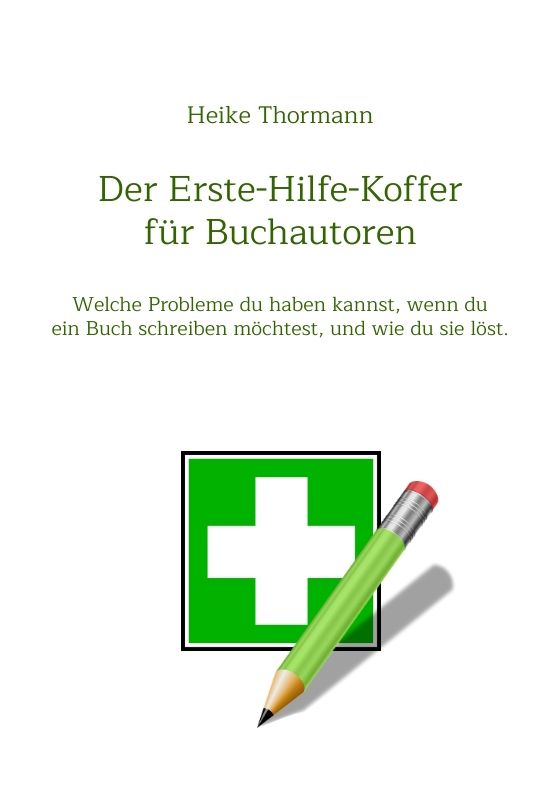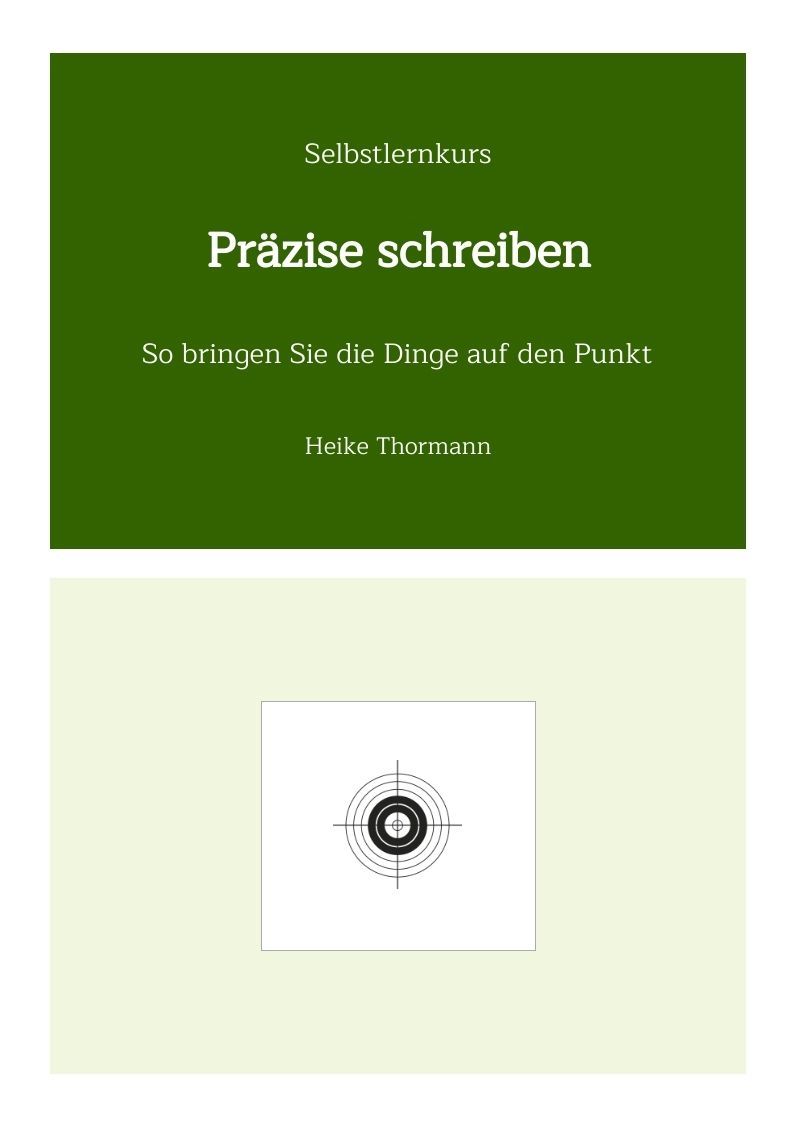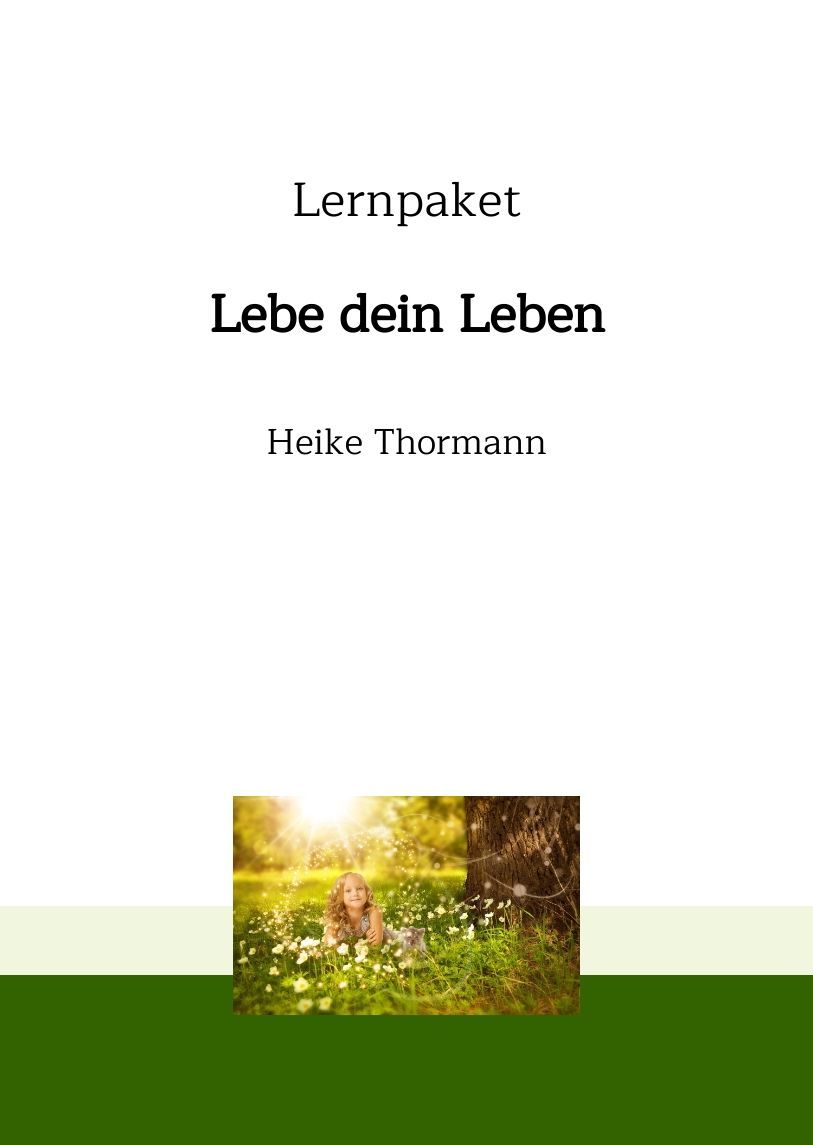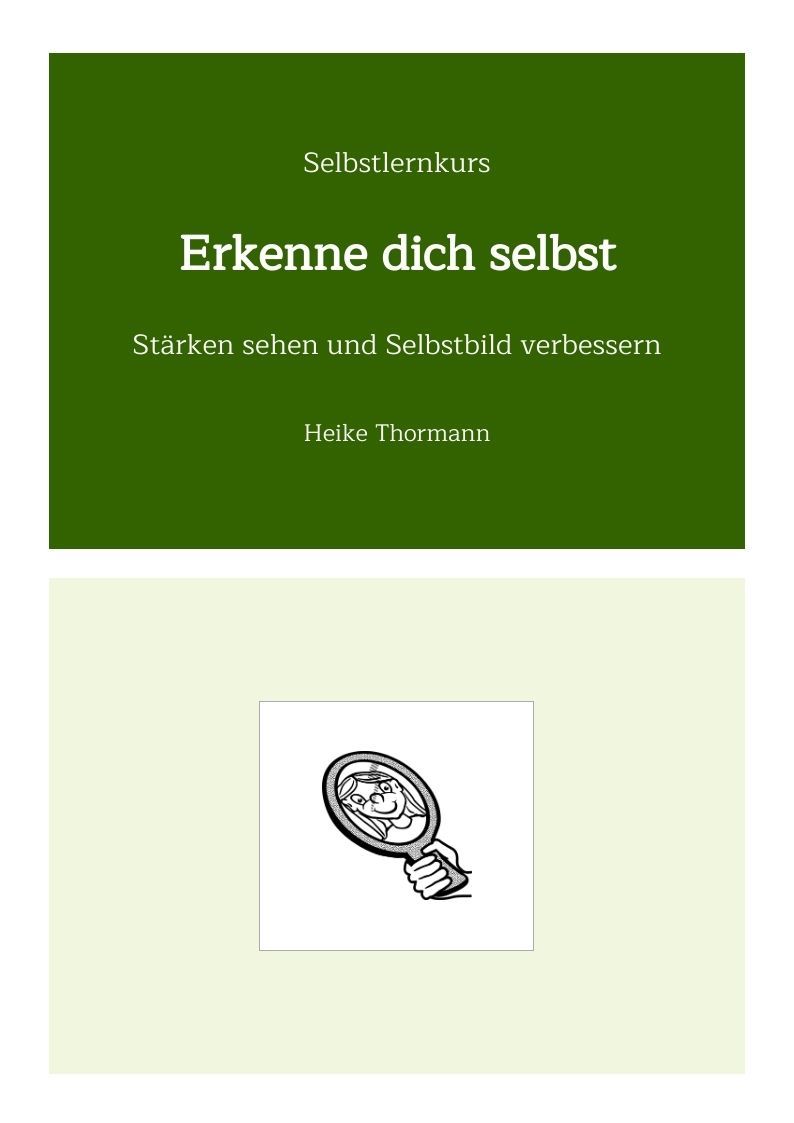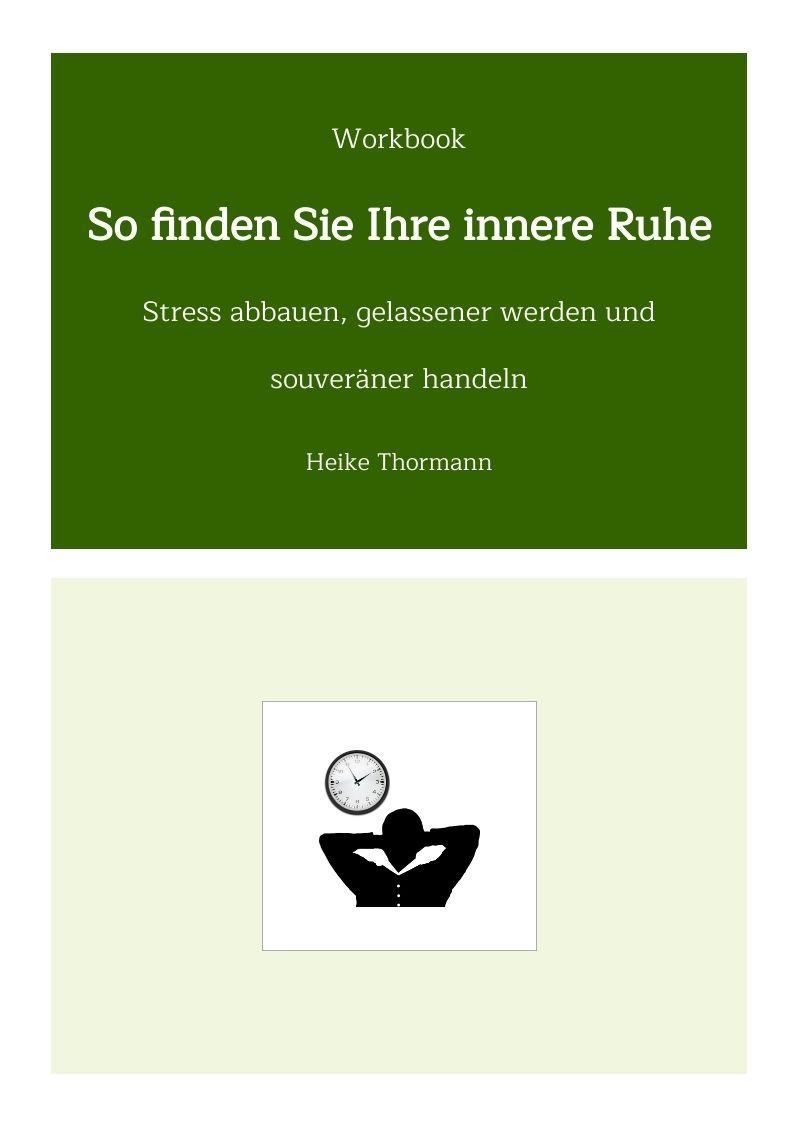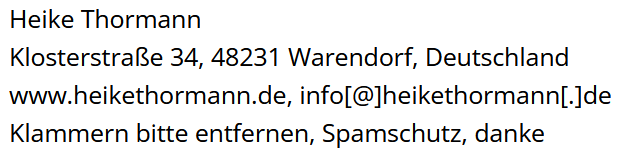Artikel
"Rechte und Pflichten als Autor oder Autorin"
von Heike Thormann
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt.
Urheberrecht, Nutzungsrecht, Hauptrecht und Nebenrecht, Rückrufrecht, Opti-onsklausel, Titelschutz, Impressumspflicht, ISBN, Buchpreisbindungsgesetz, Zitierregeln und die VG Wort … Blicken Sie noch durch? Keine Bange, ich erkläre Ihnen alles. Denn hier geht es um Ihre Rechte als Autor oder Autorin, Ihre Interessen, Ihr Geld und Ihr Wohl. Wohl bekomm‘s.
:-)
Mit „Rechte und Pflichten für Autoren“ meine ich mehreres zugleich: Es geht um das Thema Recht, bei dem sich auch Autorinnen und Autoren auskennen sollten. Es geht um die Rechte anderer, die Autoren beachten sollten. Es geht aber auch um die Rechte von Autoren, die diese kennen sollten. Und es geht um die Rechte für Autoren, auf denen sie bestehen sollten.
Zudem schicke ich eine Einschränkung gleich vorweg: Dieses Thema ist sehr komplex, ich kann es hier nur anreißen. Ich tue das aber dennoch, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, dass selbst dieses Basiswissen oft nicht vorhanden ist. (Bei mir war es das auch nicht. :-)) Und ich bin natürlich keine Rechtsexpertin, ich übernehme keine Garantie, wie es so schön heißt. Schauen Sie im Fall des Falles am besten selbst, wie der aktuelle Rechtsstand ist.
Das deutsche Urheberrecht schützt Ihre Bücher und Texte automatisch als Ihre „persönliche geistige Schöpfung“. Sie allein entscheiden, wie Sie diese Werke nutzen wollen.
Dafür müssen Sie auch nichts tun. Sie müssen Ihre Werke also nicht noch wie in den anglo-amerikanischen Ländern eigens in ein Copyright-Register eintragen. Das Zeichen © und der Copyright-/Veröffentlichungshinweis sind in Deutschland nicht notwendig. Beide können aber andere, die von dem Urheberrecht nichts wissen, auf dieses Recht hinweisen.
Möchten Sie, dass ein anderer – zum Beispiel ein Verlag oder eine Zeitung - Ihre Bücher und Texte veröffentlicht, müssen Sie diesem eine ausdrückliche Erlaubnis dazu geben. Sie müssen ihm das Recht dazu erteilen.
Von diesem Urheberschutz gibt es nur wenige Ausnahmen. So dürfen zum Beispiel ausgewählte Textpassagen gegen Beleg der Quelle zitiert werden, einzelne Teile eines Werkes für den Privatgebrauch kopiert werden oder das Werk für Unterricht und Forschung genutzt werden. (Aus dieser Nutzung kann der Autor noch über sogenannte Verwertungsgesellschaften ein Entgelt ziehen. Mehr dazu später.)
Tipp: Achten Sie als Arbeitnehmer oder Selbstständige darauf, welche Rechte Sie in Ihren Arbeits- oder Dienstverträgen abtreten. Und halten Sie bei mehreren Urhebern fest, wer an dem Werk in welchem Maße beteiligt war. Das vermeidet späteren Ärger.
Das Urheberrecht gilt lebenslang und geht nach Ihrem Tod auf Ihre Erben über. Erst 70 Jahre nach Ihrem Tod werden Ihre Werke „gemeinfrei“.
Schreiben Sie Artikel für Zeitungen, Zeitschriften und Co.? Dann können Sie diesen Medien die Nutzung Ihrer Texte auf folgende Weise erlauben:
a) Sie erteilen ihnen ein sogenanntes einfaches Nutzungsrecht. Die Zeitung darf Ihren Artikel einmal auf die verabredete Weise nutzen. Sie selbst dürfen Ihren Artikel auch noch an andere Zeitungen oder sonstige Interessenten verkaufen.
b) Sie erteilen ihnen ein sogenanntes ausschließliches Nutzungsrecht. Die Zeitung bekommt in der Regel das alleinige Recht, Ihren Artikel auf die verabredete Weise zu nutzen. Da Ihnen damit weitere Einnahmemöglichkeiten entgehen, sollten Sie sich diese Nutzungsform entsprechend besser bezahlen lassen.
Sie können die Nutzung auch weiter eingrenzen oder festlegen, zum Beispiel räumlich, zeitlich oder sachlich.
Beispiel: Zeitung A bekommt zwar ein ausschließliches Nutzungsrecht, aber beschränkt auf ihren Verbreitungsraum (räumlich) oder ihr Fachthema (sachlich). Das ist für sie günstiger, als die kompletten Rechte zu kaufen. Und sie muss diesen Artikel nicht mit der (räumlichen oder sachlichen) Konkurrenz teilen. Sie selbst dürfen diesen Artikel dagegen außerhalb der gesteckten Grenzen noch weiter nutzen.
Oder: Sie erteilen nur das Recht für den Printabdruck, nicht aber für die Online-Ausgabe oder die Sammlung diverser Artikel auf einer Beilage-CD. Möchte der Auftraggeber diese Rechte trotzdem haben, muss er dafür extra zahlen.
Rückruf: Hat ein Auftraggeber einen Beitrag nicht veröffentlicht, können Sie die Nut-zungsrechte dafür nach drei bis zwölf Monaten zurückrufen. Der Auftraggeber hat dabei das Recht auf eine angemessene Nachfrist, innerhalb derer er noch reagieren kann.
Mehr dazu lesen Sie beispielsweise im „Ratgeber Freie“ von Goetz Buchholz oder im Original unter www.gesetze-im-internet.de/urhg/.
Die Unterscheidung nach einfachem und ausschließlichem Nutzungsrecht gilt auch bei Büchern, die Sie über Verlage veröffentlichen lassen.
Hauptrecht: In aller Regel räumen Sie dem Verlag fürs Verlegen Ihres Buches ein ausschließliches Nutzungsrecht ein. Das heißt, kein weiterer Verlag und auch Sie selbst dürfen das Werk nicht nutzen. (Auch zum Beispiel nicht als E-Book für die eigene Webseite.) Ohne weitere Absprachen/Vertragsbestimmungen gilt dieses ausschließliche Nutzungsrecht für eine Auflage. Möchte der Verlag eine weitere Auflage drucken, braucht er einen neuen Vertrag.
Früher war es üblich, dieses Nutzungsrecht für die Dauer des gesetzlichen Urheberrechts zu erteilen. Davon raten Experten heute ab.
Bücher werden mittlerweile nicht mehr über Jahre von einem Verlag aktiv geführt oder gar beworben. Ein Verlag versucht heute oft, mit einem Buch einmal möglichst viel Geld zu machen, dann ist das nächste Buch fällig. Bindet sich der Autor über einen so langen Zeitraum, kann er sein Buch oft irgendwann „in der Schublade“ des Verlages suchen.
Zudem wird eine so lange Nutzungsdauer den neuen Möglichkeiten von Digitalisierung, E-Book und Selbstverlag durch Autoren nicht mehr gerecht. Autoren sind hier zu Recht unabhängiger geworden und pochen darauf, ihr Buch nicht für immer – noch dazu ohne weiteres Entgelt – aus ihren Händen gleiten zu sehen. In der Praxis werden Verlagsverträge deshalb mit einer immer kürzeren Lebensdauer geschlossen. Das gilt auch für die Print-on-Demand-Anbieter, die eine Quasi-Verlagsfunktion einnehmen, wie BOD.
Nebenrechte: Zu den Nebenrechten gehören die Nutzungsmöglichkeiten, die über Ihr eigentliches Buch/Manuskript hinausgehen. Manche unterteilen diese Nutzungsrechte auch in buchnahe und buchferne Nebenrechte.
Zu den buchnahen Nebenrechten gehören: andere Lizenzausgaben Ihres Buches wie Taschenbuchausgaben, Sonderausgaben, gekürzte Ausgaben oder Buchclub-Ausgaben, Übersetzungen und Verkauf ins Ausland oder gegebenenfalls Vorabdrucke/Nachdrucke in Zeitungen und Zeitschriften.
Zu den buchfernen Nebenrechten gehören: Bearbeitungsrechte wie Verfilmung, Vertonung, Darbietung auf Bühne oder im Vortrag, Aufnahmerechte für Radio und Fernsehen, elektronische Rechte, Werbe- und Merchandisingrechte und Verwertungsgesellschaften.
Diese Nebenrechte können Sie an den Verlag abtreten, müssen aber nicht. Wenn Sie sie abtreten, steht Ihnen für jede Nutzungsform ein weiteres Honorar zu, das Sie vertraglich mit dem Verlag aushandeln. Wenn Sie sie nicht oder in Teilen nicht abtreten, können Sie sie selbst nutzen oder zum Beispiel einer (Literatur-)Agentur zur Verwertung übergeben.
Tipp: Achten Sie darauf, dem Verlag nur die Rechte abzutreten, die der Verlag auch in Ihrem Sinne gut nutzen zu können scheint.
Beispiel: Wenn Sie eine gute Vertriebsmöglichkeit für E-Books haben, ist es sinnvoll, die elektronischen Rechte selbst zu behalten und dem Verlag nur die Rechte für den Printbereich zu übertragen. Auch hier kann ein Nutzungsrecht vertraglich für eine begrenzte Zeit festgesetzt werden.
Rückrufrecht: Auch bei einem Verlag haben Sie ein Rückrufrecht. Man unterscheidet hier im Wesentlichen zwei Varianten:
a) Der Verlag verlegt Ihr Buch nicht, vertreibt es nicht oder bewirbt es nicht - bezie-hungsweise er vertreibt und bewirbt es nur unzureichend. Dann können Sie zwei Jahre nach Vertragsabschluss beziehungsweise Manuskriptlieferung die dem Verlag übertragenen Rechte zurückrufen. Auch hier hat der Verlag das Recht auf eine Nachfrist, innerhalb derer er noch reagieren kann. (Urheberrecht §41)
b) Hält der Verlag Ihr Werk nicht mehr lieferbar und strebt auch keine neue Auflage an, können Sie vom Vertrag zurücktreten. Sie müssen dazu selbst die Lieferbarkeit kontrollieren und den Verlag schriftlich zu einer Neu-Auflage auffordern. Der Verlag hat wieder eine angemessene Nachfrist, innerhalb derer er noch reagieren kann. (Verlagsgesetz §17)
Die zurückgerufenen Rechte können Sie dann einem anderen Verlag übertragen oder als Selbstverleger selbst nutzen.
Tipp: Lassen Sie gegebenenfalls gleich im Vertrag die Regelungen für einen Rückfall der Rechte festhalten. Das vermeidet wieder spätere Streitigkeiten.
Rücktritt durch den Verlag: Übrigens kann auch der Verlag von Ihrem Buch oder genauer von dem mit Ihnen geschlossenen Vertrag zurücktreten. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn Sie einen ausgemachten Abgabetermin nicht einhalten oder wenn Ihr Manuskript erhebliche qualitative Mängel aufweist.
Auflösung oder Verkauf eines Verlags: Auch Verlage leben nicht ewig. Manchmal werden sie von anderen Verlagen übernommen, manchmal eingestellt. Will zum Beispiel im Fall einer Insolvenz der Insolvenzverwalter Ihren Vertrag nicht übernehmen, ist dieser beendet und die Rechte fallen an Sie zurück. Auch bei einer Auflösung des Verlags fallen die Rechte an Sie zurück. Kauft dagegen ein anderer Verlag „Ihren“ Verlag, muss er auch dessen Rechtspflichten übernehmen. Dieser Weiterübertragung der Rechte an den neuen Verlag können Sie aus wichtigen Gründen widersprechen, also etwa, wenn Sie sich mit dem Profil des neuen Verlags nicht identifizieren können. (Urheberrecht §34 Abs. 3) Achten Sie auch darauf, welche Einzelheiten Ihr Vertrag zum Thema Rechtsnachfolge beinhaltet. Oder lassen Sie von vornherein in Ihren Vertrag aufnehmen, dass die Übertragung der Rechte an Dritte nur in Absprache mit Ihnen erfolgen darf.
Optionsklausel: Manchmal versuchen Verlage, sich mit einer Optionsklausel sozusagen ein Vorkaufsrecht auf Ihre nächsten Bücher zu sichern. Dann müssen Sie die neuen Bücher zunächst Ihrem Altverlag vorstellen und ihm eine gewisse Zeit zum „Kauf“ geben, bevor Sie damit zu weiteren Verlagen gehen können.
Von einer solchen Klausel raten aber mittlerweile Experten sowohl von Autoren- als auch von Verlagsseite ab. Ist ein Autor mit seinem Verlag zufrieden, wird er ihm von selbst weitere Bücher anbieten. Ist er es nicht, hat es auch keinen Sinn, ihn vertraglich zu binden.
Mehr dazu lesen Sie beispielsweise wieder im „Ratgeber Freie“ von Goetz Buchholz oder im Original unter www.gesetze-im-internet.de/urhg/ und www.gesetze-im-internet.de/verlg/.
Wenn Sie Ihre Bücher selbst verlegen, müssen Sie die Rechte beachten, um die sich sonst der Verlag kümmert. Dazu gehören die folgenden Punkte:
Titelschutz: Mehr zum Thema Titelfindung und Titelschutz lesen Sie in meinem Artikel "So finden Sie einen Titel für Ihr Buch".
Impressum: Die Angaben für ein Impressum werden durch die Landespressegesetze (der Bundesländer) bestimmt. Im Wesentlichen muss ein Impressum beinhalten:
Müssen Sie Pflichtexemplare Ihres Buches bei der Deutschen Nationalbibliothek und eventuell bei der Landesbibliothek Ihres Bundeslandes abliefern? Dann kann ein Hinweis darauf ebenfalls in das Impressum gehören. Zum Beispiel so:
Bibliografische Information Der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Na-tionalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Weitere Angaben im Impressum sind freiwillig. Dazu können zum Beispiel gehören:
Den Stand der Dinge könnte man im Moment vielleicht so zusammenfassen:
Für alle Autoren gilt, egal, ob sie nun für Zeitungen, Verlage oder Selbstverlage schreiben:
Beleg- und Zitierrrecht: Beachten Sie beim Umgang mit den geistigen Schöpfungen anderer auch deren Rechte. Belegen und zitieren Sie sauber.
Rechtewahrnehmung und Honorierung durch VG Wort: Melden Sie Ihre Werke der VG Wort und nutzen Sie die Verdienstmöglichkeiten, die sie Ihnen bietet.
Die Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort) wurde 1958 gegründet, um die Nutzungsrechte und Vergütungsansprüche der bei ihr gemeldeten Autoren und Verlage zu vertreten.
Wie ich oben schon sagte, sind Ihre Werke durch das Urheberrecht geschützt. Sie allein bestimmen, wie diese genutzt werden sollen. Allerdings gibt es Ausnahmen wie etwa den Verleih durch Bibliotheken, die Nutzung für Bildung und Forschung, die Kopie einzelner Teile für den Privatgebrauch. Für diese „Nutzung durch die Gemeinheit“ steht Ihnen eine Vergütung zu.
Zu diesem Zweck erhebt die VG Wort Abgaben zum Beispiel von den erwähnten Bibliotheken, Universitäten, Schulen, Herstellern von Kopier- und Speichergeräten, Kopierläden und vielen anderen mehr.
Diese Abgaben werden nach bestimmten Schlüsseln unter den bei der VG Wort gemeldeten Werken, Autoren und Verlagen verteilt. Manchmal brauchen Sie dafür einen Wahrnehmungsvertrag, den Sie als Autorin oder Verlegerin mit der VG Wort abschließen. Manchmal geht es auch ohne, zum Beispiel bei allen Texten, die Sie ins Internet stellen.
Sie können zum Beispiel Geld bekommen für Romane und Kinderbücher, Gedichte, Sach- und Fachbücher, wissenschaftliche Publikationen, Beiträge in Zeitungen und Zeitschriften, Beiträge für Film, Funk und Fernsehen, ja sogar für Vorträge und Lesungen oder für die erwähnten Texte im Internet.
Die VG Wort prüft, ob eine gewisse Verbreitung gegeben ist. (Zum Beispiel durch Stichproben in Bibliotheken, Abrufzahlen Ihrer Internettexte oder gegebenenfalls auch Abrechnungen über Ihre verkauften Bücher.) Und Ihre Werke müssen manchmal gewisse Mindeststandards erfüllen. (Wie etwa ein Mindestumfang bei Artikeln und Internettexten.) Doch wenn das der Fall ist, sind Sie dabei und bekommen einen Happen vom Topf der VG Wort ab.
Voraussetzung ist, wie gesagt, dass Sie sich dort auf jeden Fall melden.
Mehr zur VG Wort lesen Sie zum Beispiel direkt bei ihr: www.vgwort.de.
Übrigens gibt es auch eine Verwertungsgesellschaft Bild – Kunst, die die Interessen bildender Künstler vertritt. Wenn Sie Ihre Bücher zum Beispiel auch noch selbst illustrieren oder mit Fotos versehen, können Sie sich auch bei dieser melden. Hier: www.bildkunst.de.
Wenn Sie mit den Verwertungsgesellschaften einen Wahrnehmungsvertrag abschließen, sollten Sie diese aus den Nebenrechten mancher Verlage streichen lassen.
Total Buy-Out und Konkurrenzklausel: Achten Sie auf Knebelsachen wie Total Buy-Out und Konkurrenzausschluss. Beim Total Buy-Out versucht man, alle Rechte für alle nur möglichen Nutzungen zu einem einmaligen Honorar von Ihnen zu bekommen, inklusive des Rechts, diese Rechte auch Dritten zu übertragen. Bei Konkurrenzklauseln will man zum Beispiel verhindern, dass Sie zu ähnlichen Themen auch für Konkurrenzanbieter schreiben. Das gilt sowohl für Zeitungen/Zeitschriften als auch für Verlage. Von beidem würde ich die Finger lassen. So gut kann man Sie gar nicht bezahlen, um diese Fesselung und mögliche Folgeschäden zu rechtfertigen.
Vergleichen und Verhandeln: Vergleichen Sie die Verträge mehrerer Auftraggeber oder Verlage. (Wenn Sie die Möglichkeit dazu haben.) Verhandeln Sie darüber, welche Punkte in einem Vertrag wie festgehalten werden. Sie müssen nicht alles schlucken, was man Ihnen so vorsetzt. (Es sei denn, Ihre Lage ist hoffnungslos desolat; und das sollte sie so selten wie möglich sein.) Rechte können auch Verhandlungssache sein. Sie müssen sie nur kennen, damit Sie entsprechend agieren können.
Schriftform: Halten Sie alles schriftlich fest und sei es nur, um spätere Streitereien wieder zu vermeiden und Ihre Rechte – genau :-) – zu schützen. Sind Sie bei Formulierungen unsicher? Dann können Anwälte oder Autorenvereine weiterhelfen.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.
Zudem schicke ich eine Einschränkung gleich vorweg: Dieses Thema ist sehr komplex, ich kann es hier nur anreißen. Ich tue das aber dennoch, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, dass selbst dieses Basiswissen oft nicht vorhanden ist. (Bei mir war es das auch nicht. :-)) Und ich bin natürlich keine Rechtsexpertin, ich übernehme keine Garantie, wie es so schön heißt. Schauen Sie im Fall des Falles am besten selbst, wie der aktuelle Rechtsstand ist.
Die Basis: Das Urheberrecht
Das deutsche Urheberrecht schützt Ihre Bücher und Texte automatisch als Ihre „persönliche geistige Schöpfung“. Sie allein entscheiden, wie Sie diese Werke nutzen wollen.
Dafür müssen Sie auch nichts tun. Sie müssen Ihre Werke also nicht noch wie in den anglo-amerikanischen Ländern eigens in ein Copyright-Register eintragen. Das Zeichen © und der Copyright-/Veröffentlichungshinweis sind in Deutschland nicht notwendig. Beide können aber andere, die von dem Urheberrecht nichts wissen, auf dieses Recht hinweisen.
Möchten Sie, dass ein anderer – zum Beispiel ein Verlag oder eine Zeitung - Ihre Bücher und Texte veröffentlicht, müssen Sie diesem eine ausdrückliche Erlaubnis dazu geben. Sie müssen ihm das Recht dazu erteilen.
Von diesem Urheberschutz gibt es nur wenige Ausnahmen. So dürfen zum Beispiel ausgewählte Textpassagen gegen Beleg der Quelle zitiert werden, einzelne Teile eines Werkes für den Privatgebrauch kopiert werden oder das Werk für Unterricht und Forschung genutzt werden. (Aus dieser Nutzung kann der Autor noch über sogenannte Verwertungsgesellschaften ein Entgelt ziehen. Mehr dazu später.)
Tipp: Achten Sie als Arbeitnehmer oder Selbstständige darauf, welche Rechte Sie in Ihren Arbeits- oder Dienstverträgen abtreten. Und halten Sie bei mehreren Urhebern fest, wer an dem Werk in welchem Maße beteiligt war. Das vermeidet späteren Ärger.
Das Urheberrecht gilt lebenslang und geht nach Ihrem Tod auf Ihre Erben über. Erst 70 Jahre nach Ihrem Tod werden Ihre Werke „gemeinfrei“.
Variante A: Journalistische Beiträge
Schreiben Sie Artikel für Zeitungen, Zeitschriften und Co.? Dann können Sie diesen Medien die Nutzung Ihrer Texte auf folgende Weise erlauben:
a) Sie erteilen ihnen ein sogenanntes einfaches Nutzungsrecht. Die Zeitung darf Ihren Artikel einmal auf die verabredete Weise nutzen. Sie selbst dürfen Ihren Artikel auch noch an andere Zeitungen oder sonstige Interessenten verkaufen.
b) Sie erteilen ihnen ein sogenanntes ausschließliches Nutzungsrecht. Die Zeitung bekommt in der Regel das alleinige Recht, Ihren Artikel auf die verabredete Weise zu nutzen. Da Ihnen damit weitere Einnahmemöglichkeiten entgehen, sollten Sie sich diese Nutzungsform entsprechend besser bezahlen lassen.
Sie können die Nutzung auch weiter eingrenzen oder festlegen, zum Beispiel räumlich, zeitlich oder sachlich.
Beispiel: Zeitung A bekommt zwar ein ausschließliches Nutzungsrecht, aber beschränkt auf ihren Verbreitungsraum (räumlich) oder ihr Fachthema (sachlich). Das ist für sie günstiger, als die kompletten Rechte zu kaufen. Und sie muss diesen Artikel nicht mit der (räumlichen oder sachlichen) Konkurrenz teilen. Sie selbst dürfen diesen Artikel dagegen außerhalb der gesteckten Grenzen noch weiter nutzen.
Oder: Sie erteilen nur das Recht für den Printabdruck, nicht aber für die Online-Ausgabe oder die Sammlung diverser Artikel auf einer Beilage-CD. Möchte der Auftraggeber diese Rechte trotzdem haben, muss er dafür extra zahlen.
Rückruf: Hat ein Auftraggeber einen Beitrag nicht veröffentlicht, können Sie die Nut-zungsrechte dafür nach drei bis zwölf Monaten zurückrufen. Der Auftraggeber hat dabei das Recht auf eine angemessene Nachfrist, innerhalb derer er noch reagieren kann.
Mehr dazu lesen Sie beispielsweise im „Ratgeber Freie“ von Goetz Buchholz oder im Original unter www.gesetze-im-internet.de/urhg/.
Variante B: Bücher über Verlage
Die Unterscheidung nach einfachem und ausschließlichem Nutzungsrecht gilt auch bei Büchern, die Sie über Verlage veröffentlichen lassen.
Hauptrecht: In aller Regel räumen Sie dem Verlag fürs Verlegen Ihres Buches ein ausschließliches Nutzungsrecht ein. Das heißt, kein weiterer Verlag und auch Sie selbst dürfen das Werk nicht nutzen. (Auch zum Beispiel nicht als E-Book für die eigene Webseite.) Ohne weitere Absprachen/Vertragsbestimmungen gilt dieses ausschließliche Nutzungsrecht für eine Auflage. Möchte der Verlag eine weitere Auflage drucken, braucht er einen neuen Vertrag.
Früher war es üblich, dieses Nutzungsrecht für die Dauer des gesetzlichen Urheberrechts zu erteilen. Davon raten Experten heute ab.
Bücher werden mittlerweile nicht mehr über Jahre von einem Verlag aktiv geführt oder gar beworben. Ein Verlag versucht heute oft, mit einem Buch einmal möglichst viel Geld zu machen, dann ist das nächste Buch fällig. Bindet sich der Autor über einen so langen Zeitraum, kann er sein Buch oft irgendwann „in der Schublade“ des Verlages suchen.
Zudem wird eine so lange Nutzungsdauer den neuen Möglichkeiten von Digitalisierung, E-Book und Selbstverlag durch Autoren nicht mehr gerecht. Autoren sind hier zu Recht unabhängiger geworden und pochen darauf, ihr Buch nicht für immer – noch dazu ohne weiteres Entgelt – aus ihren Händen gleiten zu sehen. In der Praxis werden Verlagsverträge deshalb mit einer immer kürzeren Lebensdauer geschlossen. Das gilt auch für die Print-on-Demand-Anbieter, die eine Quasi-Verlagsfunktion einnehmen, wie BOD.
Nebenrechte: Zu den Nebenrechten gehören die Nutzungsmöglichkeiten, die über Ihr eigentliches Buch/Manuskript hinausgehen. Manche unterteilen diese Nutzungsrechte auch in buchnahe und buchferne Nebenrechte.
Zu den buchnahen Nebenrechten gehören: andere Lizenzausgaben Ihres Buches wie Taschenbuchausgaben, Sonderausgaben, gekürzte Ausgaben oder Buchclub-Ausgaben, Übersetzungen und Verkauf ins Ausland oder gegebenenfalls Vorabdrucke/Nachdrucke in Zeitungen und Zeitschriften.
Zu den buchfernen Nebenrechten gehören: Bearbeitungsrechte wie Verfilmung, Vertonung, Darbietung auf Bühne oder im Vortrag, Aufnahmerechte für Radio und Fernsehen, elektronische Rechte, Werbe- und Merchandisingrechte und Verwertungsgesellschaften.
Diese Nebenrechte können Sie an den Verlag abtreten, müssen aber nicht. Wenn Sie sie abtreten, steht Ihnen für jede Nutzungsform ein weiteres Honorar zu, das Sie vertraglich mit dem Verlag aushandeln. Wenn Sie sie nicht oder in Teilen nicht abtreten, können Sie sie selbst nutzen oder zum Beispiel einer (Literatur-)Agentur zur Verwertung übergeben.
Tipp: Achten Sie darauf, dem Verlag nur die Rechte abzutreten, die der Verlag auch in Ihrem Sinne gut nutzen zu können scheint.
Beispiel: Wenn Sie eine gute Vertriebsmöglichkeit für E-Books haben, ist es sinnvoll, die elektronischen Rechte selbst zu behalten und dem Verlag nur die Rechte für den Printbereich zu übertragen. Auch hier kann ein Nutzungsrecht vertraglich für eine begrenzte Zeit festgesetzt werden.
Rückrufrecht: Auch bei einem Verlag haben Sie ein Rückrufrecht. Man unterscheidet hier im Wesentlichen zwei Varianten:
a) Der Verlag verlegt Ihr Buch nicht, vertreibt es nicht oder bewirbt es nicht - bezie-hungsweise er vertreibt und bewirbt es nur unzureichend. Dann können Sie zwei Jahre nach Vertragsabschluss beziehungsweise Manuskriptlieferung die dem Verlag übertragenen Rechte zurückrufen. Auch hier hat der Verlag das Recht auf eine Nachfrist, innerhalb derer er noch reagieren kann. (Urheberrecht §41)
b) Hält der Verlag Ihr Werk nicht mehr lieferbar und strebt auch keine neue Auflage an, können Sie vom Vertrag zurücktreten. Sie müssen dazu selbst die Lieferbarkeit kontrollieren und den Verlag schriftlich zu einer Neu-Auflage auffordern. Der Verlag hat wieder eine angemessene Nachfrist, innerhalb derer er noch reagieren kann. (Verlagsgesetz §17)
Die zurückgerufenen Rechte können Sie dann einem anderen Verlag übertragen oder als Selbstverleger selbst nutzen.
Tipp: Lassen Sie gegebenenfalls gleich im Vertrag die Regelungen für einen Rückfall der Rechte festhalten. Das vermeidet wieder spätere Streitigkeiten.
Rücktritt durch den Verlag: Übrigens kann auch der Verlag von Ihrem Buch oder genauer von dem mit Ihnen geschlossenen Vertrag zurücktreten. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn Sie einen ausgemachten Abgabetermin nicht einhalten oder wenn Ihr Manuskript erhebliche qualitative Mängel aufweist.
Auflösung oder Verkauf eines Verlags: Auch Verlage leben nicht ewig. Manchmal werden sie von anderen Verlagen übernommen, manchmal eingestellt. Will zum Beispiel im Fall einer Insolvenz der Insolvenzverwalter Ihren Vertrag nicht übernehmen, ist dieser beendet und die Rechte fallen an Sie zurück. Auch bei einer Auflösung des Verlags fallen die Rechte an Sie zurück. Kauft dagegen ein anderer Verlag „Ihren“ Verlag, muss er auch dessen Rechtspflichten übernehmen. Dieser Weiterübertragung der Rechte an den neuen Verlag können Sie aus wichtigen Gründen widersprechen, also etwa, wenn Sie sich mit dem Profil des neuen Verlags nicht identifizieren können. (Urheberrecht §34 Abs. 3) Achten Sie auch darauf, welche Einzelheiten Ihr Vertrag zum Thema Rechtsnachfolge beinhaltet. Oder lassen Sie von vornherein in Ihren Vertrag aufnehmen, dass die Übertragung der Rechte an Dritte nur in Absprache mit Ihnen erfolgen darf.
Optionsklausel: Manchmal versuchen Verlage, sich mit einer Optionsklausel sozusagen ein Vorkaufsrecht auf Ihre nächsten Bücher zu sichern. Dann müssen Sie die neuen Bücher zunächst Ihrem Altverlag vorstellen und ihm eine gewisse Zeit zum „Kauf“ geben, bevor Sie damit zu weiteren Verlagen gehen können.
Von einer solchen Klausel raten aber mittlerweile Experten sowohl von Autoren- als auch von Verlagsseite ab. Ist ein Autor mit seinem Verlag zufrieden, wird er ihm von selbst weitere Bücher anbieten. Ist er es nicht, hat es auch keinen Sinn, ihn vertraglich zu binden.
Mehr dazu lesen Sie beispielsweise wieder im „Ratgeber Freie“ von Goetz Buchholz oder im Original unter www.gesetze-im-internet.de/urhg/ und www.gesetze-im-internet.de/verlg/.
Variante C: Bücher über Selbstverlag
Wenn Sie Ihre Bücher selbst verlegen, müssen Sie die Rechte beachten, um die sich sonst der Verlag kümmert. Dazu gehören die folgenden Punkte:
Titelschutz: Mehr zum Thema Titelfindung und Titelschutz lesen Sie in meinem Artikel "So finden Sie einen Titel für Ihr Buch".
Impressum: Die Angaben für ein Impressum werden durch die Landespressegesetze (der Bundesländer) bestimmt. Im Wesentlichen muss ein Impressum beinhalten:
- Name/Firma und Adresse/Wohnort/Geschäftssitz des Druckers
- Name/Firma und Adresse/Wohnort/Geschäftssitz des Verlegers (beim Verlag) bzw.
- Name/Firma und Adresse/Wohnort/G. des Verfassers/Herausgebers (beim Selbstv.)
Müssen Sie Pflichtexemplare Ihres Buches bei der Deutschen Nationalbibliothek und eventuell bei der Landesbibliothek Ihres Bundeslandes abliefern? Dann kann ein Hinweis darauf ebenfalls in das Impressum gehören. Zum Beispiel so:
Bibliografische Information Der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Na-tionalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Weitere Angaben im Impressum sind freiwillig. Dazu können zum Beispiel gehören:
- Copyrightvermerk mit Jahreszahl und gegebenenfalls Auflage
- Eventuell noch ein ausführlicher Auszug zum Copyright à la: „Dieses Werk ist ur-heberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags [oder der Autorin beim Selbstverlag] unzulässig und strafbar. …“
- Eventuell noch Angaben zur Haftung à la: „Alle Angaben in diesem Buch wurden von mir nach bestem Wissen erstellt und geprüft. Für eventuelle Fehler kann ich dennoch keine Gewähr übernehmen.“
- Die diversen Dienstleister, die an der Produktion des Buches beteiligt waren.
Den Stand der Dinge könnte man im Moment vielleicht so zusammenfassen:
- Ein Buch muss überall dasselbe kosten. Das gilt auch für E-Books.
- Ausnahmen: Gebrauchte Bücher sowie Mängelexemplare mit Fehlern oder Be-schädigungen. (Diese müssen als solche gekennzeichnet sein.)
- Bücher als Werbeaktion verschenken (Ohne Bedingungen daran zu knüpfen.),
- Serienpreise oder Mengenpreise festsetzen,
- Waren von geringem Wert mit dazugeben,
- die Versand- oder Beschaffungskosten übernehmen,
- einen günstigeren Einführungspreis haben, der sich dann erhöht,
- die Verkaufspreise erhöhen, wenn das für alle Verkaufsstellen gleichzeitig gilt,
- die Buchpreisbindung ab achtzehn Monaten nach Erscheinen eines Buches offiziell aufheben und den Preis dauerhaft senken,
- Sonderausgaben produzieren wie Hardcover, Taschenbuch, Lizenzausgabe, Buchclub oder Taschenbuch-Sonderausgabe,
- Rabatte bestimmten Zielgruppen einräumen wie Buchhandlungen, Verlagen, Autoren von Verlagen, Bibliotheken und Schulen.
Variante A bis C: Für alle gilt
Für alle Autoren gilt, egal, ob sie nun für Zeitungen, Verlage oder Selbstverlage schreiben:
Beleg- und Zitierrrecht: Beachten Sie beim Umgang mit den geistigen Schöpfungen anderer auch deren Rechte. Belegen und zitieren Sie sauber.
Rechtewahrnehmung und Honorierung durch VG Wort: Melden Sie Ihre Werke der VG Wort und nutzen Sie die Verdienstmöglichkeiten, die sie Ihnen bietet.
Die Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort) wurde 1958 gegründet, um die Nutzungsrechte und Vergütungsansprüche der bei ihr gemeldeten Autoren und Verlage zu vertreten.
Wie ich oben schon sagte, sind Ihre Werke durch das Urheberrecht geschützt. Sie allein bestimmen, wie diese genutzt werden sollen. Allerdings gibt es Ausnahmen wie etwa den Verleih durch Bibliotheken, die Nutzung für Bildung und Forschung, die Kopie einzelner Teile für den Privatgebrauch. Für diese „Nutzung durch die Gemeinheit“ steht Ihnen eine Vergütung zu.
Zu diesem Zweck erhebt die VG Wort Abgaben zum Beispiel von den erwähnten Bibliotheken, Universitäten, Schulen, Herstellern von Kopier- und Speichergeräten, Kopierläden und vielen anderen mehr.
Diese Abgaben werden nach bestimmten Schlüsseln unter den bei der VG Wort gemeldeten Werken, Autoren und Verlagen verteilt. Manchmal brauchen Sie dafür einen Wahrnehmungsvertrag, den Sie als Autorin oder Verlegerin mit der VG Wort abschließen. Manchmal geht es auch ohne, zum Beispiel bei allen Texten, die Sie ins Internet stellen.
Sie können zum Beispiel Geld bekommen für Romane und Kinderbücher, Gedichte, Sach- und Fachbücher, wissenschaftliche Publikationen, Beiträge in Zeitungen und Zeitschriften, Beiträge für Film, Funk und Fernsehen, ja sogar für Vorträge und Lesungen oder für die erwähnten Texte im Internet.
Die VG Wort prüft, ob eine gewisse Verbreitung gegeben ist. (Zum Beispiel durch Stichproben in Bibliotheken, Abrufzahlen Ihrer Internettexte oder gegebenenfalls auch Abrechnungen über Ihre verkauften Bücher.) Und Ihre Werke müssen manchmal gewisse Mindeststandards erfüllen. (Wie etwa ein Mindestumfang bei Artikeln und Internettexten.) Doch wenn das der Fall ist, sind Sie dabei und bekommen einen Happen vom Topf der VG Wort ab.
Voraussetzung ist, wie gesagt, dass Sie sich dort auf jeden Fall melden.
Mehr zur VG Wort lesen Sie zum Beispiel direkt bei ihr: www.vgwort.de.
Übrigens gibt es auch eine Verwertungsgesellschaft Bild – Kunst, die die Interessen bildender Künstler vertritt. Wenn Sie Ihre Bücher zum Beispiel auch noch selbst illustrieren oder mit Fotos versehen, können Sie sich auch bei dieser melden. Hier: www.bildkunst.de.
Wenn Sie mit den Verwertungsgesellschaften einen Wahrnehmungsvertrag abschließen, sollten Sie diese aus den Nebenrechten mancher Verlage streichen lassen.
Total Buy-Out und Konkurrenzklausel: Achten Sie auf Knebelsachen wie Total Buy-Out und Konkurrenzausschluss. Beim Total Buy-Out versucht man, alle Rechte für alle nur möglichen Nutzungen zu einem einmaligen Honorar von Ihnen zu bekommen, inklusive des Rechts, diese Rechte auch Dritten zu übertragen. Bei Konkurrenzklauseln will man zum Beispiel verhindern, dass Sie zu ähnlichen Themen auch für Konkurrenzanbieter schreiben. Das gilt sowohl für Zeitungen/Zeitschriften als auch für Verlage. Von beidem würde ich die Finger lassen. So gut kann man Sie gar nicht bezahlen, um diese Fesselung und mögliche Folgeschäden zu rechtfertigen.
Vergleichen und Verhandeln: Vergleichen Sie die Verträge mehrerer Auftraggeber oder Verlage. (Wenn Sie die Möglichkeit dazu haben.) Verhandeln Sie darüber, welche Punkte in einem Vertrag wie festgehalten werden. Sie müssen nicht alles schlucken, was man Ihnen so vorsetzt. (Es sei denn, Ihre Lage ist hoffnungslos desolat; und das sollte sie so selten wie möglich sein.) Rechte können auch Verhandlungssache sein. Sie müssen sie nur kennen, damit Sie entsprechend agieren können.
Schriftform: Halten Sie alles schriftlich fest und sei es nur, um spätere Streitereien wieder zu vermeiden und Ihre Rechte – genau :-) – zu schützen. Sind Sie bei Formulierungen unsicher? Dann können Anwälte oder Autorenvereine weiterhelfen.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.
Literaturtipps:
Von Manfred Plinke gibt es überdies ein Spezialbuch zum Thema, über das ich aber nichts weiter sagen kann: Manfred Plinke: Recht für Autoren. Urheberrecht, Verlagsrecht, Musterverträge.
(*)
(*) Partner-Link zu Amazon, kleine Umsatzbeteiligung für mich
Copyright Heike Thormann
Auf dieser Webseite veröffentlicht am 21.11.2024
Erstveröffentlichung 2016, letzte Überarbeitung 2024